| »SCHULE MACHEN« – LUXEMBURG 2/2021
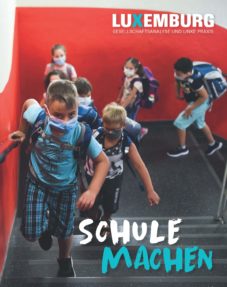

Das Homeschooling war für Lehrer*innen, Schüler*innen und Eltern eine enorme Herausforderung. Für viele war es aber auch Anlass, Schule ganz anders zu machen.
| mehr »

Wenn Schulen nach ihrem Abi-Durchschnitt gerankt werden, sind Schüler*innen mit schlechten Startbedingungen ein »Problem«. Die Konkurrenz um Bildungschancen ist eng mit Rassismus und Klassenverhältnissen verschränkt.
| mehr »

Schulisches Lernen mit praktischer Arbeit zu verbinden,ist eine der frühen Ideen der sozialistischen Bewegung. Für heute könnte sie neu gedacht werden.

Kämpfe um sexuelle Selbstbestimmung betonen die individuelle Entscheidungsfreiheit. Nicht selten geraten gesellschaftliche Machtverhältnisse aus dem Blick. Das Konzept reproduktiver Gerechtigkeit ermöglicht neue strategische Perspektiven und Allianzen.
In den letzten Jahren ist immer öfter von reproduktiver Gerechtigkeit die Rede, wenn es um soziale Ungleichheit im Zusammenhang mit Kinderbekommen geht. Das Konzept der Reproductive Justice wurde 1994 von Schwarzen Feministinnen in den USA entwickelt und ist inzwischen weltweit ein Bezugsrahmen für feministische Bewegungen, die Fragen von Mutter- beziehungsweise Elternschaft herrschafts- und machtkritisch angehen wollen.
| mehr »

30 Jahre nach Ende der Diktatur bekommt Chile eine neue Verfassung. Dieser Prozess ist auch das Ergebnis von Kämpfen, die sich in den letzten Jahren vor allem um die soziale Reproduktion dreht.
Das lateinamerikanische Musterland Chile steckt in einer tiefen politischen Krise. Erste Ergebnisse dieser Umbruchphase sind die systematische Diskreditierung des Neoliberalismus, die Tatsache, dass sich das Land endlich eine neue Verfassung geben wird, und dass dem verfassungsgebenden Prozess eine indigene Frau vorsteht. Elisa Loncón entstammt dem Volk der Mapuche, das in der chilenischen Politik traditionell weitgehend ausgeschlossen wurde.
| mehr »

Um Azubis geht es in der Debatte um eine sozial-ökologische Transformation fast nie, dabei sind sie die Arbeitskräfte von morgen. Warum ist das so?
Die gute Nachricht ist: Auch in linken Diskursen wächst ein gewisses Interesse an der beruflichen Bildung. Das ist nicht selbstverständlich, das Thema wird doch vielfach mit spitzen Fingern angepackt. Die Prozeduren der beruflichen Bildung gelten häufig als Paradebeispiel einer unkritischen Sozialpartnerschaft. Zweitens wird vermutet, dass sich Fragen der beruflichen Bildung in erster Linie um die Steigerung der betrieblichen Wettbewerbsfähigkeit drehen. Und drittens gibt es da den eher akademischen Vorbehalt, dass berufliche Bildung als ökonomische Zweckbildung um ein verkürztes, wenn nicht verstümmeltes Bildungsverständnis kreist, also um das, was man in Anlehnung an Max Horkheimer als »instrumentelle Vernunft« bezeichnen könnte.
| mehr »

Warum sitzt das Gymnasium so fest im Sattel, werden nicht Gemeinschaftsschulen immer beliebter?
Susanne: Eine kurze Antwort wäre an dieser Stelle preisverdächtig. Sicherlich hängt vieles damit zusammen, dass wir immer noch in einer Klassengesellschaft leben. Ich fürchte, das muss man wohl so sagen. Zur 25-Jahr-Feier der Laborschule Bielefeld und des Oberstufenkollegs hat Ludwig von Friedeburg es etwa so ausgeführt: Heute kann man sich sozial nicht mehr zeigen oder abgrenzen durch Statussymbole wie ein eigenes Haus, ein großes Auto oder tolle Fernreisen, nur noch durch den Satz »Mein Kind geht aufs Gymnasium.« Immer noch müssen sich Kinder und Jugendliche, die Gemeinschaftsschulen besuchen, gegenüber Gymnasiast*innen verteidigen, dass sie nicht »nur« aufgrund von mäßigen Leistungen auf eine solche Schule gehen. Die Vorurteile gegenüber reformpädagogisch orientierten Schulen sind in unserer Gesellschaft tief verwurzelt, als könnte nur über Konkurrenz aller gegen alle der soziale Aufstieg oder wenigstens der erreichte soziale Status gesichert werden.
| mehr »

CO2-Preise polarisieren. Während manche darin ein Allheilmittel sehen, werden sie in linken Kreisen oft als sozial ungerecht abgelehnt. Doch so einfach ist es nicht.
Wer in den 1990er Jahren irgendetwas mit Ökologie am Hut hatte, zitierte irgendwann den Klassiker »Die Preise müssen die ökologische Wahrheit sagen.« Damit wollte Umweltforscher Ernst Ulrich von Weizsäcker angesichts der wachsenden Umweltprobleme klarmachen, dass die Kosten von Umweltschäden endlich Eingang in die betriebliche Kalkulation finden müssen, unter anderem über die Einführung von Ökosteuern. Heute dagegen scheint Weizsäckers Maxime bei mancher*m Linken Teufelszeug.
| mehr »

Stell dir vor, alle könnten Abitur machen. Wie würde dann entschieden, wer welche Jobs übernimmt? Aus sozialistischer Perspektive muss Bildungsgerechtigkeit mit der Frage nach einer demokratischen Teilung der Arbeit verbunden werden.