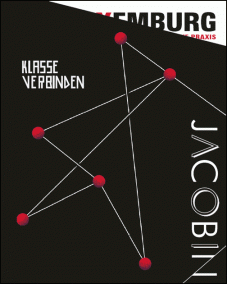| Das rote Wien
Sozialistische Stadt im konservativen Staat
Das Rote Wien (1919–1934) stellt bis heute für verschiedene progressive Kräfte einen emphatischen oder auch kritisch-solidarischen Orientierungspunkt linker Stadtpolitik dar. International war und ist das gesellschaftspolitische Reformprojekt der Zwischenkriegszeit vor allem durch den sozialen Wohnungsbau bekannt. Aber auch umfassende Reformen in der Sozial- und Gesundheitspolitik sowie ein breit angelegtes Erziehungs-, Kultur- und Bildungsprogramm charakterisierten das kommunalpolitische Projekt bis zu dessen Zerschlagung im Jahr 1934.
Das Rote Wien war eine historisch spezifische, sozialdemokratische Antwort auf noch heute aktuelle gesellschaftspolitische Fragen, wie jene nach der Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums, nach dem Zugang zu sozialer und öffentlicher Infrastruktur oder der (Re-)Organisation der Reproduktionsarbeit. Vor dem Hintergrund aktueller Herausforderungen linker (Stadt-)Politik – den Kämpfen um das Recht auf Wohnen, den Anti-Austeritäts-Protesten oder Strategien gegen Rechts – richten wir den Blick auf dieses historische Projekt der Kommunalpolitik inmitten der krisenhaften Zwischenkriegszeit sowie auf die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen fortschrittlicher Stadtpolitik in einem konservativ regierten Staat.
Entstehungs- und Durchsetzungsbedingungen
Noch heute prägen die Bau- und Infrastrukturmaßnahmen der Zwischenkriegszeit das Stadtbild Wiens. Auch in anderen europäischen Städten wie Frankfurt am Main (Neues Frankfurt) oder Zürich (Rotes Zürich) wurden nach dem Ersten Weltkrieg städtische Reformprojekte angestoßen, keines war jedoch derart umfassend angelegt wie das des Roten Wiens. Eine zentrale Bedingung für die Durchsetzung des Projekts war eine starke Arbeiter-, Frauen- und Rätebewegung nach dem Ersten Weltkrieg. Die gesellschaftspolitische Situation war geprägt von Hunger, massiver Arbeitsund Wohnungslosigkeit sowie einer politischen Polarisierung. Gegen Kriegsende erlebte das Land eine Welle von Demonstrationen und Streiks. In den Fabriken und Stadtteilen Wiens, aber auch in anderen Industriegebieten wurden nach dem Vorbild der Russischen Revolution sowie der Räterepubliken in Deutschland und Ungarn Arbeiterräte gebildet. Die sozialrevolutionäre Situation nach dem Zerfall der Monarchie eröffnete den Raum für gesellschaftliche Veränderungen. Mit der Ausrufung der Republik Österreich im November 1918 wurde das lang umkämpfte allgemeine und gleiche Wahlrecht für Männer und Frauen realisiert. In den ersten Wahlen erlangte die Sozialdemokratie die Mehrheit der Stimmen. Von der bis 1920 auf Bundesebene bestehenden Koalitionsregierung aus Sozialdemokratie und konservativ-katholischer Christlich-Sozialer Partei wurden wohlfahrtsund sozialstaatliche Maßnahmen durchgesetzt, die eine unmittelbare Verbesserung der Lebensverhältnisse bedeuteten, etwa der Achtstundentag, bezahlter Urlaub, das Betriebsrätegesetz, die Gründung der Arbeiterkammer oder ein Gesetz zum Mieter*innenschutz. Befördert wurde das Reformprojekt zudem durch die Beschaffenheit der österreichischen Sozialdemokratie. Deren Stärke beruhte vor allem auf der organisatorischen Integration verschiedener radikaler und revolutionärer Strömungen. Während Teile der Partei mit dem politischen Gegner verhandelten, konnten sie diesem zugleich mit dem Druck der Bewegungen Zugeständnisse abringen (Perspektiven 2010). In diesem Zusammenhang spielte auch der bis heute bestehende Bezug auf die Einheit der Partei eine große Rolle. Anders als in Deutschland gab es keine großen Abspaltungen und die Kommunistische Partei konnte sich neben der Sozialdemokratie – abgesehen von der Zeit der Illegalität unter Austrofaschismus und Nationalsozialismus – nicht behaupten. Bei den Wiener Gemeinderatswahlen erreichte die Sozialdemokratie stets die absolute Mehrheit. Die Stimmengewinne bedeuteten, dass nicht nur Arbeiter*innen sozialdemokratisch wählten, sondern die Partei auch Stimmen aus den neuen Angestelltenschichten des öffentlichen und privaten Sektors an sich binden konnte.
Zugleich zeigten sich rasch die Herausforderungen einer sozialistischen Stadt im konservativen Staat. Die Partei war außerparlamentarisch – durch den Schutzbund (ihr militärischer Arm), die Gewerkschafts- und Arbeiterbewegung auf der Straße und in den Betrieben – präsent, ihre Stellung im Roten Wien stellte einen realen Machtfaktor dar. Die Stadt verfolgte ein politisches Projekt, das im Gegensatz zum Kurs der Bundesregierung und teilweise auch zum Verhalten der stärker reformistisch-konsensorientierten Bundespartei der Sozialdemokratie stand. Das Rote Wien war jedoch von konservativ dominierten Bundesländern umgeben. Bereits zu Beginn der 1920er Jahre verschob sich das Kräfteverhältnis sukzessive zuungunsten der Arbeiterund Frauenbewegung, in der öffentlichen Debatte wurde der Aufruf wiederholt, den »revolutionären Schutt« zu entfernen. Nach dem Ende der Koalition 1920 war die Sozialdemokratie zudem an keiner Bundesregierung mehr beteiligt. 1922 weitete sich – ähnlich wie in Deutschland – die kriegsbedingte Inflation aus. Der Währungsverfall endete erst, als der Völkerbund deklarierte, die Garantien für eine Auslandsanleihe zu übernehmen. Der Plan zur ›Sanierung‹ des Staatshaushaltes sah Einnahmensteigerungen und Ausgabensenkungen vor, die zulasten breiter Teile der Bevölkerung durchgeführt wurden.
Stadtpolitik in der Zwischenkriegszeit
Der Fokus der Sozialdemokratie richtete sich auf den Aufbau des kommunalpolitischen Projekts in Wien. Umstrukturierungen in allen Lebensbereichen sollten den »neuen Menschen« formen und die Antizipation einer sozialistischen Gesellschaft in einer Stadt ermöglichen. Die ideologische Grundlage dieses Ansatzes war der Austromarxismus: Ein Projekt zwischen Revolution und Reform anstrebend, sollte die Sozialdemokratie über den Weg des Stimmzettels zum Sozialismus schreiten. Die politische Strategie konzentrierte sich darauf, in der Stadt Hegemonie aufzubauen (Rabinbach 1989).
Die Stadtregierung intervenierte mit einem massiven Investitions- und Infrastrukturprogramm in die wirtschaftliche Krise der Nachkriegszeit. Sie tat dies von Beginn an unter massiver Kritik bürgerlicher und rechter Kräfte. In der Opposition zur Politik der Sozialdemokratie fanden die Bundesregierung, der Hauptverband der Industrie, Banken, Unternehmen, die Kirche und die faschistischen und paramilitärischen Verbände der Heimwehren zusammen (Tálos/Manoschek 2005, 8).
Die finanzielle Basis für die Reformen schuf die Stadtregierung durch eine breit angelegte steuerliche Umverteilung. Möglich war dies, nachdem Wien im Jahr 1922 zu einem eigenen Bundesland geworden war und damit in der Steuerpolitik einen größeren Handlungsspielraum gewonnen hatte. Die nach dem Finanzstadtrat Hugo Breitner benannte Breitner-Steuer wurde auf Luxusgüter und -konsum wie Automobile, Pferde(rennen) oder Hauspersonal erhoben. Zentral war zudem die sozial gestaffelte Wohnbausteuer, die insbesondere auf Villen und Hausbesitz zielte, Wohnungen von Arbeiterhaushalten aber mehr oder weniger unbelastet ließ.
Mithilfe eines breit angelegten Konjunkturprogramms wurde massiv in die soziale und öffentliche Infrastruktur und in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen investiert sowie im Reproduktionsbereich eine Welle der Kommunalisierung und Verstaatlichung in Gang gesetzt. Das kam vielen der heute unter dem Begriff Care verhandelten Bereiche – von der Sozialpolitik über die Pflege und Versorgung bis hin zur Erziehung und Bildung – in Form von infrastrukturellen Maßnahmen und beträchtlichen Ressourcen zugute. Es erfolgte der Ausbau von Fürsorge- und Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche, von modernen Pflegeheimen und der allgemeinen medizinischen Versorgung. Die Stadtverwaltung trieb eine Schulreform mit reformpä- dagogischen Ansätzen voran und baute das Angebot der Erwachsenenbildung aus. Überall wurden Bibliotheken, oft in Gemeindebaukomplexen, eröffnet. Ein weitverzweigtes Netz an öffentlich subventionierten Vereinen hatte sich die kulturelle Bildung der Gesellschaft auf die Fahnen geschrieben und vertrat damit ein umfassendes Erziehungs- und Modernisierungsprojekt. Zugleich wurde über die Errichtung neuer Brücken, Straßen, Parks und Promenaden die städtebauliche Umgestaltung vorangetrieben. (Weihsmann 2002; Podbrecky 2003, Mattl 2000)
Entkommodifizierung des Wohnraums und sozialer Wohnungsbau
Im 19. Jahrhundert war Wien, damals Reichshaupt- und Residenzstadt der K.-u.-K.- Doppelmonarchie Österreich-Ungarn, mit über zwei Millionen Einwohner*innen zu einer Großstadt angewachsen. 1910 war Wien nach London, New York, Paris und Chicago die fünftgrößte Stadt weltweit. Arbeitsmigration aus verschiedenen Teilen der Habsburgermonarchie ließ das industrielle Zentrum expandieren. Überbelegte Wohnungen in Häusern der Gründerzeit ohne Licht und Luftzufuhr, Elendsviertel und Zinskasernen, in denen mehrere Generationen auf kleinstem Raum hausten, waren Kennzeichen der Wohn- und Lebensverhältnisse breiter Teile der Bevölkerung. Die Mieten waren hoch, sogenannte Bettgeher wechselten Schlafstellen im Schichtbetrieb, und die als Wiener Krankheit bezeichnete Tuberkulose oder die typische Proletarierkrankheit Rachitis waren weit verbreitet.
Der massiven Wohnungsnot nach dem Ersten Weltkrieg begegnete die Stadtregierung zuerst mit der Errichtung von Notquartieren, teils durch die Aneignung leerstehender Gebäude. Sie wandte sich gegen die Spekulation mit Wohnraum und kaufte sukzessive Grundstücke auf. Im Jahr 1924 war sie die größte Grundbesitzerin in Wien. In mehreren Etappen wurden zwischen 1923 und 1934 über 60 000 neue Wohnungen gebaut (Podbrecky 2003, 16). Die umfangreichen Baumaß- nahmen fungierten zugleich als Arbeitsbeschaffungsprogramm. Die Stadtregierung unterstützte auch die Siedlungsbewegung, wobei tendenziell eher Skepsis gegenüber dem Modell des Ein- und Mehrfamilienhauses bestand. Gemeindebauten setzten sich als dominierende Bauform durch. Die bürgerlichen Kräfte wetterten gegen die Geldverschwendung der »roten Burgen«, denen eine militärische Funktion unterstellt wurde. Als die Bauarbeiten am Karl-Marx-Hof begannen, der um die 1 400 Wohnungen umfasste, hieß es, dieser drohe einzustürzen. Als das berühmte Amalienbad entstand, warnte man davor, die Ausstattung würde von den proletarischen Nutzer*innen gestohlen werden.
Bei den im Roten Wien errichteten Gemeindebauten handelte es sich um mehrgeschossige Wohnblocks, deren begrünte Innenhöfe Licht und Sonne garantieren sowie ein Gemeinschaftsgefühl und Solidarität unter den Bewohner*innen stärken sollten. Die Wohnblöcke waren an lokale Infrastruktureinrichtungen wie Konsumgenossenschaften und Bildungseinrichtungen angeschlossen, was eine Nahversorgung und die Organisation des Alltags erleichtern sollte. Die Wohnungen, die in der Regel über eine Wohnküche, ein Zimmer und manchmal ein zusätzliches Kabinett verfügten, waren zwischen 38 und 48 Quadratmeter groß und mit fließendem Wasser und Toiletten ausgestattet. Auch Forderungen der Frauen- und Arbeiterbewegung fanden Eingang in die neuen Formen des kommunalen Wohnungsbaus. Diskussionen um Rationalisierung und Zentralisierung der Hauswirtschaft spiegelten sich architektonisch in der Errichtung von Kinderbetreuungsstätten, Zentralwaschküchen, dem sogenannten Einküchenhaus und der Wohnküche wider. Beabsichtigt war, klassische ›weibliche‹ Reproduktionsarbeiten von staatlicher Seite zu übernehmen und so die durch Lohnarbeit, Haushalt und Kindererziehung mehrfach belasteten Proletarierinnen zu entlasten. Die in der Fachliteratur geäußerten Einschätzungen zu den wohlfahrtsstaatlichen Einrichtungen betonen einerseits die Verbesserung der Lebensverhältnisse der Arbeiter*innen, andererseits das Moment der Kontrolle und Disziplinierung sowie der Verfestigung der geschlechtersezifischen Arbeitsteilung. (Gruber 1998, 57; Hauch 2009, 157; Pirhofer/ Sieder 1982).
Mit den Gemeindebauten sollte ebenso wie mit den kommunalisierten Unternehmen und Dienstleistungen kein Gewinn erwirtschaftet werden. Die Stadtverwaltung übernahm bereits in Gemeindehand befindliche Betriebe (zum Beispiel Gas-, Wasser und Elektrizitätswerke, Verkehrsbetriebe) und setzte die Kommunalisierung fort (Müllabfuhr, Kanalisation etc.). Die Wohnungsmiete wurde kostendeckend berechnet und betrug 1926 um die vier Prozent eines durchschnittlichen Arbeitermonatslohns (Podbrecky 2003, 19). Die Vergabe der Wohnungen folgte einem gestaffelten Punktesystem. Ein zentrales Kriterium waren neben Bedürftigkeit wie Wohnungslosigkeit, Arbeitsverlust oder Kriegsinvalidität, ob jemand »in Wien geboren« war. Dies zählte vier Mal so viel wie die österreichische Staatsbürgerschaft (Weihsman 2003, 37). Damit galt der Grundsatz: Wer in der Stadt lebte, sollte hier auch wohnen bleiben können. Mit der Weltwirtschaftskrise von 1929 geriet das Rote Wien jedoch immer stärker unter Druck (Maier/Maderthaner 2012).
Krise und Austerität
Während in den USA die Regierung Roosevelt mit dem New Deal, einem Programm von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und konjunkturpolitischen Interventionen, auf die Weltwirtschaftskrise reagierte, setzte die österreichische Bundesregierung in der Ersten Republik eine Politik der Austerität durch. Die ›Rettung‹ des Staates in der Krise durch Völkerbundanleihen war an Konditionen gebunden, Vertreter des Finanzkomitees des Völkerbundes reisten nach Österreich und entwarfen gemeinsam mit der Regierung ein weiteres ›Sanierungsprogramm‹. Der Abbau der sozialen Infrastruktur, von Arbeitsplätzen und Arbeitnehmerrechten wurde maßgeblich durch sogenannte Notverordnungen vorangetrieben, womit das Parlament und demokratische Entscheidungsfindungsprozesse umgangen wurden. In den Medien der Arbeiterbewegung wurde die auch heute wieder aktuelle Frage »Wer zahlt für die Krise?« aufgeworfen:
»Die Krise! Geschäftsleute verlangen Steuererleichterungen, Fabrikanten den Abbau der ›sozialen Lasten‹ […]. Doch existiert die Krise […] nicht erst recht bei denen, über die nie gesprochen wird, bei den Arbeitern, Angestellten und Beamten? Erst recht! Denn an ihnen will man Lohn ersparen, Fürsorgekosten sparen, sie müssen mehr Steuern zahlen, damit die direkten Steuern abgebaut werden können […]. In Zeiten der Krise sollen alle geschützt werden, nur arbeitenden Menschen, besonders Frauen und Jugendlichen wird noch genommen.« (Die Frau 3/1931, 4)
Regierung und Vertreter des Finanzkomitees des Völkerbundes verheimlichten nicht, dass sie die parlamentarische Demokratie als Störfaktor der ›Sanierung‹ empfanden. Die Etablierung autoritärer Strukturen wurde mit dem Verweis auf wirtschaftliche Notwendigkeiten gerechtfertigt. Die Sozialdemokratie kritisierte die Politik der Kürzungen, trug sie aber dennoch auf Bundesebene teilweise mit. Die Zerschlagung des wohlfahrtsstaatlichen Projekts des Roten Wiens weist Ähnlichkeiten mit den autoritär durchgesetzten neoliberalen Maßnahmen in Reaktion auf die jüngste Krise auf (Blyth 2013; Duma/Hajek 2015, Duma et al. 2014) und erinnert zugleich an den immer geringer werdenden Handlungsspielraum von Kommunen unter dem Druck der Schuldenbremse (Wiegand in diesem Heft).
Im Verlauf der damaligen Krise stieg der Druck der bürgerlich-konservativen Bundesregierung auf die Kommunalverwaltung Wiens, Einsparungen vorzunehmen und Abgaben einzutreiben (Vgl. z.B. Die Frau 8/1931, 2 und 10/1933, 7; Arbeiter-Zeitung, 11. 6.1931, 1–4). Zugleich schlug sich die Krise im Haushalt der Stadt nieder. Während auf Bundesebene ein Austeritätskurs eingeschlagen wurde, versuchte Wien insbesondere im Bereich des Wohnungsbaus das Investitionsprogramm weiterzuführen – wenn auch in verringertem Ausmaß. Sitzungen des Wiener Gemeinderates standen »im Zeichen der Sparsamkeit« (Arbeiter-Zeitung, 13.6.1931, 5). Die Kommunistische Partei, die weder im Parlament noch im Gemeinderat vertreten war, aber das Projekt des Roten Wien stets kritisch begleitete, protestierte gegen den Sparkurs. Sie warf der »Roten Gemeinde« die Entlastung der »notleidenden« Wirtschaft auf Kosten der »notleidenden Arbeiterschaft« vor. Auf Bundesebene versuchte die Sozialdemokratie, Ideen für Arbeitsbeschaffungsprogramme, Investitionen sowie eine Umverteilung über das Steuersystem einzubringen, doch es blieb bei Vorschlägen. Im Zuge der militärischen Niederschlagung der Arbeiterbewegung im Februar 1934 setzte das austrofaschistische Regime die Stadtregierung ab und einen Regierungskommissär an deren Stelle ein. Eine der ersten Maßnahmen der austrofaschistischen Verwalter im Roten Wien war die Aufhebung des progressiven lokalen Steuersystems. Die steuerliche Umverteilung von oben nach unten wurde rückgängig gemacht. Das Projekt des öffentlichen Wohnbaus wurde weitestgehend beendet, der Mietzins erhöht, das Sozialversicherungsnetz und die soziale Infrastruktur wurden abgebaut.
Resümee
Trotz der heute veränderten politischen Konstellationen und der unterschiedlichen Zusammensetzung der gesellschaftlichen Linken eröffnet die Aktualisierung dieser Fragestellungen Möglichkeiten, auf Erfahrungen oder Strategien aufzubauen. In ganz Europa gibt es Kämpfe gegen Zwangsräumungen (auch von Mieter*innen von kommunalen Wohnungen), Forderungen nach der Nutzung von leerstehenden Gebäuden und Wohnungen für neu Ankommende (zum Beispiel Geflüchtete) führen an vielen Orten zu Mobilisierungen der Linken. Die Erfahrungen des Roten Wiens zeigen, dass auf kommunaler Ebene weitreichende transformatorische Ideen in einer Situation zur Realität werden konnten, in der massiver Druck ›von unten‹ aufgebaut werden konnte.
Trotz der Tatsache, dass auch Wien von Verdrängungsprozessen und steigenden Mieten nicht ausgenommen ist, weist die Stadt noch heute ein relativ hohes Budget für den öffentlich subventionierten Wohnbau auf. Voraussetzung für das damalige Reformprojekt war eine politische Kraft, eine Kombination aus Bewegungs- und Organisierungsprojekt, die auf große Teile der Subalternen bauen und einen Raum für weitergehende Veränderungen eröffnen konnte. Zugleich zeigt das Beispiel des Roten Wiens, wie wichtig es ist, die Zentren der Macht auf lokaler, nationaler und überregionaler Ebene in Angriff zu nehmen. Die Autonomie in der Steuerpolitik eröffnete einen großen Handlungsspielraum, der jedoch mit dem Eingreifen des Zentralstaates, flankiert vom Völkerbund und schließlich mit der Etablierung des Austrofaschismus zerstört wurde. Innerhalb der Linken wurde recht kontrovers über die richtige Strategie der Partei diskutiert. Die Sozialistin, Aktivistin und Sozialwissenschaftlerin Käthe Leichter, die während des Nationalsozialismus ermordet wurde, bezeichnete die Vermeidung der Machtfrage als fundamentalen Fehler im Kampf gegen den Austrofaschismus. Die linke Bewegung habe »den Glauben an die schöpferische Kraft der Arbeiterbewegung selbst, das Selbstvertrauen in die eigene Aktions- und Gestaltungskraft« verloren (Leichter 1933; zit. nach Rabinbach 1989, 140). Der Blick auf historische Entwicklungen sollte dazu dienen, aktuelle Ansätze einer emanzipatorischen Politik zu stärken. Dabei kommt es darauf an, die Dynamiken von sozialen Bewegungen ebenso wie die der parlamentarisch organisierten Kräfte in all ihren Widersprüchen strategisch zusammenzudenken und sich den gegenwärtig Zumutungen wie der Austeritätspolitik und dem Aufstieg der Rechten zu widersetzen.
Literatur
Blyth, Mark, 2013: Austerity. The History of a Dangerous Idea, New York
Duma, Veronika/Hajek, Katharina, 2015: Haushaltspolitiken. Feministische Perspektiven auf die Weltwirtschaftskrisen von 1929 und 2008, in: Kühschelm, Oliver (Hg.), Geld-Markt-Akteure, Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 26, 46–76
Dies./Konecny, Martin/Lichtenberger, Hanna, 2013: Krisenbearbeitung im historischen Vergleich: Österreich und Griechenland, in: Brie, Michael (Hg.): »Wenn das Alte stirbt …«. Die organische Krise des Finanzmarktkapitalismus, Reihe Manuskripte 8, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Berlin, 157–190
Gruber, Helmut, 1998: The »New Women«: Realities and Illusions of Gender Equality in Red Vienna, in: ders./ Graves, Pamela (Hg.), Women and Socialism. Socialism and Women. Europe Between the Two World Wars, New York/Oxford, 56–94
Hauch, Gabriella, 2009: Machen Frauen Staat? Geschlechterverhältnisse im politischen System, in: dies., Frauen bewegen Politik. Österreich 1848–1938, Innsbruck u.a., 151–170
Maier, Michaela/Maderthaner, Wolfgang, 2012: Im Bann der Schattenjahre. Wien in der Zeit der Wirtschaftskrise 1929 bis 1934, Wien
Mattl, Siegfried, 2000: Wien im 20. Jahrhundert, Wien Perspektiven. Magazin für Linke Theorie und Praxis, »Wie Rot ist Wien?«, Sommer 2010, Nr. 11
Pirhofer, Gottfried/Sieder, Reinhard, 1982: Zur Konstitution der Arbeiterfamilie im Roten Wien. Familienpolitik, Kulturreform, Alltag und Ästhetik, in: Mitterauer, Michael/ Sieder, Reinhard (Hg.), Historische Familienforschung, Frankfurt a.M., 326–369
Podbrecky, Inge, 2003: Rotes Wien. Gehen & Sehen. 5 Routen zu gebauten Experimenten. Von Karl-Marx-Hof bis Werkbundsiedlung, Wien
Rabinbach, Anson, 1989: Vom Roten Wien zum Bürgerkrieg, Wien
Tálos, Emmerich/Manoschek, Walter, 2005: Zum Konstituierungsprozess des Austrofaschismus, in: Tálos, Emmerich/Neugebauer, Wolfgang (Hg.), Austrofaschismus. Politik–Ökonomie–Kultur 1933–1938, Münster, 6–27
Weihsmann, Helmut, 2002: Das Rote Wien. Sozialdemokratische Architektur und Kommunalpolitik 1919–1934, Wien