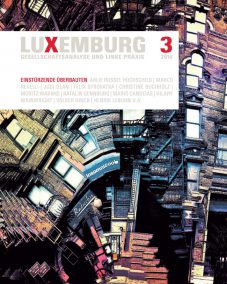| Wie ich feministische Sozialistin wurde

Lieber als über sozialistischen Feminismus möchte ich hier über feministischen Sozialismus sprechen. Als Studentin in Oxford war ich 1970 an der ersten Konferenz der Neuen Frauenbewegung im Ruskin College dabei. Meine ganze Welt geriet damals aus den Fugen. Bis zu diesem Punkt war meine Sicht auf die Welt ziemlich hierarchisch gewesen. Für Frauen hieß das, es ging darum, innerhalb des Systems aufzusteigen. Der aufkommende Feminismus brachte all das durcheinander. Er forderte jede Hierarchie grundlegend heraus.
Uns ging es damals weder um »Chancengleichheit« noch um Gleichheit innerhalb des bestehenden Systems. Uns beschäftigte etwas völlig anderes. Wir waren auf der Suche nach radikalen Alternativen und versuchten diese zu entwickeln, indem wir sie in unserem Alltag lebten. Feminismus war etwas sehr Persönliches. Um die Welt zu verändern, begannen wir bei uns selbst. Wir hatten dieses unermessliche Vertrauen in uns selbst und ein Gefühl der Macht, das nicht zuletzt aus den intimen Formen der Solidarität hervorging, die wir insbesondere in den Selbsterfahrungsgruppen machten. Es war ein Prozess ständiger (Selbst-)Veränderung.
Als Kind war ich ziemlich laut, ausgelassen und wild gewesen, doch bei den Treffen der damaligen Linken, etwa der Revolutionären Sozialistischen Studenten in Oxford, war ich eher leise. Lange verstand ich nicht wirklich, warum. Zum Teil hatte es mit den Typen im Raum zu tun, darunter waren vielleicht sogar ein oder zwei, die mir ganz gut gefielen. Das machte mich irgendwie zu einem stillen, zögerlichen Menschen, und das kam mir seltsam vor.
Der Feminismus und die mit anderen Frauen geteilten Erfahrungen erlaubten es mir, die Gründe dafür zu verstehen – und auch, wie sich die Beziehungen und die Kultur, die diese produzierten, verändern ließen, indem wir uns organisierten. Der Geist von 1968 war noch sehr lebendig. Die damalige Zeit gab mir die politische Zuversicht, weiterzukämpfen und meinen Optimismus zu bewahren. Einen Optimismus, der darauf zurückging, dass ich Teil einer Bewegung war, die für sehr radikale Veränderungen eintrat.
Ich war eher linksliberal erzogen worden, doch durch 1968 hatte ich begonnen, diesen bürgerlichen Humanismus abzulehnen. Mir wurde klar, dass die Liberalen, obwohl sie vorgaben, sich neben individueller Freiheit auch für soziale und ökonomische Gleichheit einzusetzen, diese niemals durchsetzen würden. Denn dazu bedurfte es einer Umverteilungspolitik, die den Kapitalismus herausfordern würde, also Vermögenssteuern und höhere Steuern auf Unternehmensgewinne und so etwas. Aber genau das wollte das liberale Bürgertum eben nicht.
Ich wurde Sozialistin, wusste jedoch, dass ich sowohl das sowjetische Modell als auch das fabianische von Harold Wilson, damals Premierminister und Vorsitzender von Labour, ablehnte. Ich experimentierte mit der Einsicht, dass ein Ende des Kapitalismus notwendig war, ohne jedoch genau zu wissen, was Sozialismus war. In meinem Denken verschmolzen Feminismus und Sozialismus. Rückblickend war es der Feminismus, der mir die Werkzeuge in die Hand gab, für eine neue Art des Sozialismus zu streiten. Das erste Werkzeug hat mit Macht zu tun, das zweite mit Wissen und das dritte mit dem Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft.
Zwischen Macht und Ermächtigung
Was ich über das transformative Wesen der Macht lernte war, dass wir Macht besaßen – und zwar in einem alltäglichen Sinne. Wir waren es, die ständig unsere eigene Unterdrückung reproduzierten, als Sexualpartnerinnen, als Mütter und als Beschäftigte, in allen möglichen Momenten: in unserer Passivität, in den Repräsentationen unserer selbst. Also hatten wir zwei Möglichkeiten: diese Macht entweder weiter zu reproduzieren oder es nicht zu tun. Und von einer solchen Verweigerung ist es nur ein kleiner Schritt zur echten Veränderung.
Es gab also diese Kraft, die in uns selbst steckte, in unserer Fähigkeit, soziale Beziehungen durch unsere eigenen Aktivitäten im Alltag zu verändern. Das half mir, mir darüber klar zu werden, weshalb ich das sogenannte leninistische Verhältnis von staatlicher und Parteimacht ablehnte, ebenso wie das fabianische Verständnis von Macht, wonach der Staat Zugeständnisse machte und Politiken
verabschiedete, anstatt Macht als Ermächtigung aller zu denken.
So begann ich, mich mit Arbeiten zu verschiedenen Formen von Macht zu beschäftigen, von John Holloway über Steven Lukes bis hin zu Roy Bhaskar.
Es gibt Macht als Beherrschung, was praktisch unserem Verständnis von Regierung entspricht: die Macht ergreifen, um dann die Hebel zu nutzen, die für die Ausführung von Politik zur Verfügung stehen. Das wird gemeinhin als »Macht über« verstanden.
Dann gibt es Macht als transformative Kraft: die Macht, Dinge zu ändern, Dinge zu tun – diese wird auch »Macht zu« genannt. Die Frauenbewegung verstand diese Art von Macht als Kopplung von transformativer Macht und entsprechender Selbstermächtigung – wie ich glaube, auch heute noch ein sehr brauchbares Konzept. Occupy und die Indignados haben es genutzt. Sie waren auf den Plätzen und schufen eine andere Art von Gesellschaft, oder zeigten sie zumindest in ihrer täglichen Praxis auf.
Ich wurde auch durch die Betriebsräteund Gewerkschaftsbewegung in ihrer radikalsten und alternativsten Phase beeinflusst – als sie nicht einfach nur mit Fabrikbesetzungen gegen Entlassungen und Standortschließungen protestierten, sondern sagten: »Wir haben Fertigkeiten, praktische Fertigkeiten, die eine Basis für andere Arten der Produktion bilden können.« Sozial sinnvolle Produkte statt Raketen etwa, oder Produkte, die den Wandel der Industrie zu weniger Kohlenstoffverbrauch unterstützen können.
Diese transformative Kraft der ›Massen‹ anzuerkennen, verändert das Konzept des Sozialismus vollkommen. Ein Konzept, das so oft ausschließlich auf der Idee von »Macht über« beruht – etwa wenn die Produktionsmittel und Ressourcen übernommen werden, um sie dann auf paternalistische Weise zu verteilen. Ohne die Art von Macht anzuerkennen, die die Leute schon haben – die Fähigkeit etwas abzulehnen und zu verändern. Ohne anzuerkennen, dass auch die vorhandenen Machtstrukturen abhängig sind von realen Menschen als wissenden und kreativen Wesen.
Praktisches Wissen vergesellschaften
Das zweite Werkzeug bezieht sich auf Wissen. Was ich von den Selbsterfahrungsgruppen wie auch von den Betriebsräten gelernt habe, war die Bedeutung unterschiedlicher Formen von Wissen. Die meisten traditionellen sozialistischen Parteien, ob leninistisch oder fabianisch, glauben an intellektuelle Führung.
Wissen wurde traditionell in sehr enger szientistischer Weise verstanden, wobei Gesetze als die Korrelation von Ursache und Wirkung galten, die kodifiziert, zentralisiert und dann über einen zentralen Apparat als Grundlage einer wissenschaftlichen Form der Planung dienen sollten.
Die Frauenbewegung hingegen begann in ihren Selbsterfahrungsgruppen oft mit Geschichten und Gerede – mit Formen von Wissen also, die nicht anerkannt waren. Ein Wissen, das in Gefühlen und täglicher Erfahrung verborgen liegt, jedoch am Ende zu politischen Prozessen führt: der Bildung von Frauengesundheitspraxen, einer weiten Spanne von Bildungsprojekten, Frauennotrufen, allen Arten von Frauenzentren.
Diese von Frauen entwickelten Politiken resultierten aus ihren Erfahrungen und Problemen, sie gingen also auf ihr praktisches Wissen zurück. In ähnlicher Weise verhielt es sich mit den radikalen Betriebsräten: Sie schrieben keine langen, auf wissenschaftlichen Gesetzen basierenden Papiere, sondern entwarfen alternative Produkte. Sie wussten, ihr Wissen war vielleicht ›implizit‹, eher praktisch; aber es konnte geteilt und durch neue Praxen explizit gemacht und damit sozialisiert werden.
Einmal las ich (zu meiner Schande sei’s gesagt) Hayek und es war ein ziemlicher Schock, denn er schrieb über dieses implizite Wissen (tacit knowledge) – also Dinge, die wir wissen, aber kaum ausdrücken können. Hayek argumentierte, Wissen werde zwar durch die Individuen generiert, könne jedoch nur durch die spontanen Bewegungen des Marktes koordiniert werden. Er verwendete einen Begriff von praktischem Wissen zur Fundierung seiner Theorie des Neoliberalismus.
In den sozialen Bewegungen haben wir hingegen gelernt, dass es weder um eine Entscheidung zwischen wissenschaftlichem und praktischem Wissen geht, noch – und das ist das Wichtigste – dass das Praktische immer individuell ist, wie Hayek es behauptete. Soziale Bewegungen, und insbesondere die Frauenbewegung, haben gezeigt, dass implizites Wissen teilbar ist und vergesellschaftungsfähig – und sie haben solches Wissen generiert. Das war es, was wir damals taten. Soziale Beziehungen und Verhältnisse waren entscheidend.
Welche Beziehungen waren dafür notwendig? Das praktische Wissen musste geteilt, musste vergesellschaftet werden, um zur Grundlage einer neuen Art von Planung werden zu können – von Planung im Sinne von vorausschauendem Handeln, während es gleichzeitig galt, stets aufs Neue zu experimentieren und empfänglich zu bleiben für das noch zu Entdeckende. Macht sowohl als Ermächtigung wie auch als Beherrschung zu verstehen und Wissen als praktisch implizites ebenso wie als wissenschaftlich – das legte die Basis für ein gänzlich anderes Verständnis von Sozialismus.
Individuum und Gesellschaft
Das dritte Werkzeug hat mit dem Verhältnis zwischen dem Individuellen und der Gesellschaft zu tun. In der Frauenbewegung drehte sich alles um individuelle Selbsterfahrung. Wir waren zuallererst als Individuen aktiv, aufgrund unseres persönlichen Schmerzes, unserer Unterdrückung und unserer Gefühle. Doch wir begriffen schnell, dass wir unser Potenzial als Frauen ohne eine soziale Bewegung, ohne Macht, niemals verwirklichen können, dass es also nötig war, die Strukturen zu verändern, die den jeweiligen unterdrückerischen sozialen Beziehungen zugrunde lagen – und dies auch im Bündnis mit anderen sozialen Bewegungen.
Gegenwärtig entwickeln sich neue Formen der politischen Organisierung, die wirklich spannend sind. Sie entwickeln sich in direkter Aktion und legen Wert auf Horizontalität und Konsens. Doch mitunter wird – vor allem von jungen Männern – so getan, als sei all das völlig neu. Es stimmt, wir gebrauchten damals nicht exakt dieselbe Sprache über Netzwerke, doch waren unsere ersten Frauengruppen selbst Netzwerke, und wir vernetzten sie. Wir erkundeten auf praktische Weise diese netzwerkartigen Formen von Organisierung.
Mir geht es nicht darum zu sagen: »Wir waren die Ersten!« Und doch: Ist es nicht relevant, dass einige dieser Ideen und Neuerungen ihren Ursprung in einer Befreiungsbewegung haben, einer Bewegung, die sich in Emanzipationskämpfen gegen eine besonders intime und sozial verankerte Form von Hierarchie herausgebildet haben?
Wie können wir dafür sorgen, dass deutlich wird, wie wichtig die Bedingungen sind, unter denen Menschen leben, dass es von ihnen abhängt, ob solche Erkenntnisse überhaupt möglich sind, Erkenntnisse, die Menschen nur gewinnen, während sie kämpfen? Eine weitere Frage ist die, wie wir Macht als transformative Kraft mit Macht als Beherrschung verbinden können. Als Frauenbewegung versuchten wir beispielsweise, öffentliche Gelder für Kindertagesstätten, Notrufe und Frauenzentren zu bekommen. All diese Praxen entstanden aus unserer Macht als transformative Kraft, als Ermächtigung. Doch dies allein reichte nicht. In den Worten eines damals sehr einflussreichen Buches mussten wir gleichzeitig »innerhalb und gegen den Staat« arbeiten.1 Es ging darum, dessen Umverteilungspotenzial, dessen Formen der sozialen Sicherung und die Räume, die er öffnete, zu verteidigen und auszubauen; zugleich jedoch galt es, die Art und Weise radikal zu verändern, in der öffentliche Mittel verteilt wurden, wer sie verwaltete und mit wessen Hilfe dies geschah.
Im Greater London Council, dem damals klar links profilierten Stadtrat des Großraums London, wo ich Anfang der 1980er Jahre unter der Führung von Ken Livingstone arbeitete, machten wir dies zu einem Kernprinzip. Es war klar, dass der Staat nicht von sich aus für all die genannten Projekte und Einrichtungen sorgen würde; und natürlich übertrugen wir diese Aufgabe erst recht nicht dem Markt, für den das öffentliche Interesse an Care unbedeutend ist und der – jenseits des Profits – auch über keinerlei nicht monetären Instrumente verfügt, um gesellschaftliche Wohlfahrt zu messen. Aber wir übertrugen gesellschaftliche Ressourcen an »transformative Gruppen«, beispielsweise an unterschiedliche Frauengruppen. Wir arbeiteten auch innerhalb und gegen den Markt – mit dem Unternehmensausschuss des Großraums London ebenso wie
in Kooperation mit Genossenschaften. Wenn wir vor diesem Hintergrund nun Parteien wie Podemos und Syriza betrachten, die (wie ambivalent und prekär auch immer) aus sozialen Bewegungen hervorgegangen sind und nun an die Macht wollen oder bereits an die Regierung gekommen sind – was können wir dann mitnehmen aus der Erfahrung des feministischen Sozialismus, der in und gegen den Staat gearbeitet hat?
War dies letztlich eine Sackgasse? Wurden wir einfach unserer Kraft beraubt, geschwächt, inkorporiert? Oder gab es ein Potenzial für eine andere Art von Staat – jenseits der üblichen Unterscheidung von mehr oder weniger Staat –, gab es ein Potenzial, das nicht realisiert wurde, weil der feministische Sozialismus nicht kompromisslos genug war? Oder wurde er einfach durch Margaret Thatcher und den neoliberalen Angriff besiegt und zum Stillstand gebracht? Es würde sich lohnen, an die damaligen Debatten des feministischen Sozialismus anzuknüpfen und diese weiterzuentwickeln.
Dieser Artikel erschien zuerst auf der Website des Jacobin Magazins. Aus dem Englischen von Corinna Genschel und Corinna Trogisch
1 »In and Against the State« wurde 1979 von einem Autorenkollektiv namens London Edinburgh Weekend Return Group veröffentlicht, einer Arbeitsgruppe der Conference of Socialist Economists. Das Buch analysiert die widersprüchlichen Erfahrungen, die Beschäftigte im Öffentlichen Dienst in den 1970er Jahren machten, die sich explizit als Sozialist*innen verstanden. Zu den Autor*innen gehörten Jeanette Mitchell, Donald Mackenzie, John Holloway, Cynthia Cockburn, Kathy Polanshek, Nicola Murray, Neil McInnes and John McDonald.