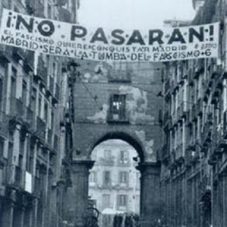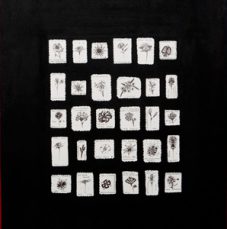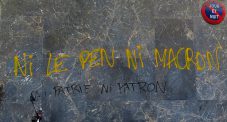| Scholz in der SPD – Same procedure, different year

Das Gespenst, so hat das politstrategische Personal der Union entschieden, ist zurück in Europa. Die Inszenierung der CDU/CSU als einsame Verteidigerin der besitzenden Klasse gegen eine rote Bedrohung ist so alt wie verlogen. Die SPD ist in der Praxis seit über zwanzig Jahren keine sozialdemokratische Kraft mehr, alle Beteiligten wissen das. Trotzdem muss in aller Nüchternheit festgehalten werden: es gelingt der gesellschaftlichen Linken nicht, dieses Theater angemessen zu entlarven.