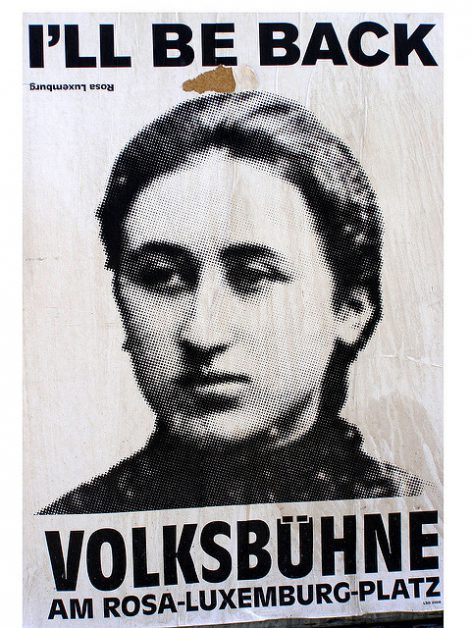| Radikalität und Sanftheit. Rosa Luxemburg als sozialistische Feministin
Wenn es bei Rosa Luxemburg einen Grundtenor gibt, dann die Rebellion gegen jede Herrschaft des Menschen über den Menschen. Die jamaikanische Philosophin Sylvia Wynter hat gezeigt, wie koloniale Herrschaft auf der Unterscheidung und Hierarchisierung zweier Typen von Menschen (»Man1« und »Man2«) basieren. Dabei geht es stets um die Frage, wem eine Seele und volle Menschlichkeit zugesprochen wird und wem nicht. Luxemburgs Konzepte sind eng verknüpft mit dem Projekt, diese Unterscheidung im Namen einer menschlichen Praxis zu überwinden – und damit auch Imperialismus, Kolonialismus und Kapitalismus.
Ich möchte Luxemburg im Folgenden als eine ethische Feministin begreifen. Diesem Feminismus, von dem ich spreche, geht es nicht allein um den Kampf für Frauenrechte, sondern auch um die Überwindung einer bestimmten Vorstellung von »Menschheit« (Benhabib u. a. 1994). So stellen Luxemburgs Ideen der sozialistischen Transformation auch »Man1 und Man2« und deren Rassismus infrage. Feministische und antirassistische Kämpfe sind untrennbar verbunden. Rosa Luxemburg war mit ihrem Ruf nach Solidarität mit den Frauen des globalen Südens ihrer Zeit weit voraus. Doch was genau schrieb sie eigentlich über die »Frauenfrage«?
Luxemburg (1912) stimmte mit Charles Fouriers Ausspruch überein, der Grad der weiblichen Emanzipation sei das Maß der allgemeinen Emanzipation. Unermüdlich kämpfte sie für ein allgemeines Wahlrecht, das auch Frauen umfasst. Dennoch wies sie auf Klassenunterschiede zwischen Frauen hin: Bürgerliche Frauen seien in erster Linie Konsumentinnen und damit auch Profiteurinnen des Systems, ihr Klasseninteresse damit gegen den Sozialismus gerichtet. Luxemburg setzte auf die proletarischen Frauen, die damals das Recht auf Versammlung und Gründung eigener Gewerkschaften erstritten. Luxemburg sah in diesen Frauen das Potenzial einer sozialistischen Transformation und war überzeugt, sie würden die absurden Widersprüche des Kapitalismus angehen – wie etwa die Tatsache, dass weibliche Hausarbeit scheinbar keinen Wert für das kapitalistische System produziert.
»Von diesem Standpunkt ist die Tänzerin im Tingeltangel, die ihrem Unternehmer mit ihren Beinen Profit in die Tasche fegt, eine produktive Arbeiterin, während die ganze Mühsal der Frauen und Mütter des Proletariats in den vier Wänden ihres Heimes als unproduktive Tätigkeit betrachtet wird. Das klingt roh und wahnwitzig, entspricht aber genau der Rohheit und dem Wahnwitz der heutigen kapitalistischen Wirtschaftsordnung, und diese rohe Wirklichkeit klar und scharf zu erfassen, ist die erste Notwendigkeit für die proletarischen Frauen« (ebd., 241).
Hausarbeit und Frauen im Kapitalismus
Dennoch hätte sich Luxemburg die Forderungen mancher sozialistischer Feministinnen nach Lohn für die Hausarbeit nie zu eigen gemacht. Für sie stand fest, dass die Gesetze des Kapitalismus jede solche Errungenschaft zunichte machen würden. In ihrer Vorstellung von Sozialismus, wie sie ihn insbesondere in ihren Briefen darlegt, würde nicht bloß die Hausarbeit sozialisiert, sondern die gesamte Familienstruktur umgestaltet, die die Unterdrückung der Frau festschreibt. Er würde eine radikale Transformation aller menschlichen Beziehungen erfordern. Darum insistierte Luxemburg darauf, dass eine kommunistische Partei nach der Machtübernahme die größte vorstellbare Form von Demokratie anstreben müsse. Das Ergebnis müsste eine Sozialisierung dessen sein, was heute privat ist.
»In der modernen Proletarierin wird das Weib erst zum Menschen, denn der Kampf macht erst den Menschen, den Anteil an der Kulturarbeit, an der Geschichte der Menschheit. Für die besitzende, bürgerliche Frau ist ihr Haus die Welt. Für die Proletarierin ist die ganze Welt ihr Haus, die Welt mit ihrem Leid und ihrer Freude, mit ihrer kalten Grausamkeit und ihrer rauhen Größe« (Luxemburg 1914, 410).
Da für Luxemburg die Klassenfrage zentral war, hätte sie die feministische Debatte um eine Ethik der Care-Arbeit in den 1990er und 2000er Jahren eher als deplatziert empfunden. Sie hätte es abgelehnt, die Werte zu idealisieren, die im Kapitalismus mit der weiblichen Hausarbeit verbunden sind. Luxemburg sah in ihr »die Stickluft ihres engen Daseins« oder »die kümmerliche Geistlosigkeit und Kleinlichkeit des häuslichen Waltens« (ebd., 241).
Gender, »Rasse« und Klasse
Für Luxemburg gehörte zur Klassensolidarität auch die Solidarität mit Frauen aus dem globalen Süden, deren Unterdrückung integraler Bestandteil imperialer Herrschaft war. Angesichts ihres Beharrens darauf, dass Imperialismus und damit Krieg im Kapitalismus unvermeidbar sind, darf dies nicht überraschen.:
»Eine Welt weiblichen Jammers wartet auf Erlösung. Da stöhnt das Weib des Kleinbauern, das unter der Last des Lebens schier zusammenbricht. Dort in Deutsch-Afrika in der Kalahariwüste bleichen die Knochen wehrloser Hereroweiber, die von der deutschen Soldateska in den grausen Tod von Hunger und Durst gehetzt worden sind. Jenseits des Ozeans, in den hohen Felsen des Putumayo, verhallen, von der Welt ungehört, Todesschreie gemarterter Indianerweiber in den Gummiplantagen internationaler Kapitalisten. Proletarierin, Ärmste der Armen, Rechtloseste der Rechtlosen, eile zum Kampfe um die Befreiung des Frauengeschlechts und des Menschengeschlechts von den Schrecken der Kapitalherrschaft. Die Sozialdemokratie hat dir den Ehrenplatz angewiesen. Eile vor die Front, auf die Schanze!« (Luxemburg 1914, 412f)
Die Forderung nach Frieden ist eine mögliche Forderung von Frauen im globalen Norden und Süden. Damit war Luxemburg eine der Ersten, die erkannte, dass die Unterdrückung schwarzer Menschen kein Nebenaspekt des Kapitalismus, sondern für die Klassenherrschaft genauso fundamental ist wie der Militarismus. Rassismus ist integraler Bestandteil kapitalistischer Herrschaft, weshalb es keine Frauen gibt, auf die die Kategorie »Rasse« nicht angewandt würde. Die Debatten, ob Geschlecht, »Rasse« oder Klasse Priorität haben, übersehen Luxemburgs Argument, dass es Krieg geben wird, solange es Kapitalismus gibt, und dass der Kampf gegen Militarismus immer Teil des sozialistischen Kampfes sein muss.
Genau darum nenne ich Luxemburg eine ethische Feministin: Ihr Anti-Elitismus entspringt der Annahme, dass es keine Menschen zweiter Klasse gibt und dass Gleiches für die gewaltförmige Hierarchie zwischen Nationen gilt. Hierauf gründet auch ihre Kritik an Konzepten der Avantgardepartei. Für Luxemburg muss die Partei in den täglichen Kämpfen der Massen verwurzelt sein, weshalb sie Lenins Konzept der Zentralisierung ablehnte.
»Sagen wir doch unter uns offen heraus: Fehltritte, die eine wirklich revolutionäre Arbeiterbewegung begeht, sind geschichtlich unermesslich fruchtbarer und wertvoller als die Unfehlbarkeit des allerbesten Zentralkomitees« (Luxemburg 1904, 444).
In heutigen psychoanalytischen Begriffen gesprochen richtete sich ihre Kritik an Lenins und Trotzkis hierarchischem Verständnis der Beziehung von Partei und Masse als »phallische Fantasie«: Eine kleine Gruppe von Männern hat die Macht, eine unvollkommene Bewegung vor Fehlern zu bewahren.
Luxemburg kritisierte die Bolschewiki nach der Machtübernahme 1917 zudem insbesondere für deren Unterstützung einer Politik der nationalen Selbstbestimmung. Sie sah den Nationalismus als ein perfektes Instrument für die angeschlagene Bourgeoisie, wieder in die Offensive zu kommen. Ihre Sprache erinnert an Fanons Kritik der nationalen Bourgeoisie in den antikolonialen Befreiungskämpfen, in denen häufig nur die Eliten ausgetauscht wurden und die Kontrolle der Produktionsmittel in den Händen der weißen Besitzer verblieb (Fanon 1963). Hier wurde nationale Selbstbestimmung genau zu der von Luxemburg kritisierten leeren Fassade. An der Linie der nationalen Selbstbestimmung der Bolschewiki störte Luxemburg zudem der mit dieser Art Nationalismus stets verbundene imperiale Militarismus. Doch dies war nicht ihr einziger Kritikpunkt.
Freiheit und Demokratie
Die Bolschewiki hatten sich vor ihrer Machtübernahme für eine gewählte verfassunggebende Versammlung ausgesprochen. Die Wahl fand dann allerdings unter schwierigen Bedingungen statt – ein Großteil der ländlichen Bevölkerung hatte von der Revolution noch gar nichts erfahren. Die Bolschewiki verfehlten die Mehrheit und lösten die Versammlung unter der Parole »Alle Macht den Sowjets« gewaltsam auf. Als die Sowjets dann zu aufmüpfig wurden, wurden auch sie entmachtet. Luxemburg räumte zwar ein, dass das Wahlgesetz in der konkreten Situation wenig Sinn hatte, auch weil es weite Teile der Arbeiterklasse ausschloss. Dennoch forderte sie, das allgemeine Wahlrecht anzustreben, trotz aller Risiken, und obwohl sie zugestand, dass zuweilen eine Entrechtung von Teilen der herrschenden Klasse notwendig sein konnte. Trotzki und Lenin stellten jedoch zunehmend demokratische Institutionen an sich infrage.
»Nach Trotzkis Theorie widerspiegelt jede gewählte Versammlung ein für allemal nur die geistige Verfassung, politische Reife und Stimmung ihrer Wählerschaft just in dem Moment, wo sie zur Wahlurne schritt. Die demokratische Körperschaft ist demnach stets das Spiegelbild der Masse vom Wahltermin […] Jeder lebendige geistige Zusammenhang zwischen den einmal Gewählten und der Wählerschaft, jede dauernde Wechselwirkung zwischen beiden wird hier geleugnet.« (Luxemburg 1918, 354)
Luxemburg hielt das Gegenteil für richtig. Zwar glaubte sie nicht an eine dauerhafte Zukunft der verfassunggebenden Versammlung nach der bolschewistischen Revolution. Sie sprach jedoch gegen deren gewaltsame Auflösung und trat für Neuwahlen ein. Sie forderte, Zeit in die Organisierung zu stecken, um die Menschen vom neuen System zu überzeugen und mit der Beteiligung an der Wahl auch eine Möglichkeit zu schaffen, das massenhafte revolutionäre Bewusstsein zu stärken.
Nach Luxemburgs Verständnis erfordert der Wandel zur sozialistischen Gesellschaft eine radikale Transformation jedes Einzelnen. Das ähnelt dem Argument von Wynter, dass wir materiell an Elitismus, Rassismus und Sexismus gekoppelt sind – durch die Art, wie unser Zusammenleben und unsere Arbeit strukturiert sind. Lenin glaubte hingegen, dass es möglich sei, die brutale disziplinierende Struktur der kapitalistischen Fabrik zu übernehmen und für ein rigides Produktionsregime zu nutzen. Dem widersprach Rosa Luxemburg aufs Schärfste: Die Organisation der Arbeit, die Familie, ja, selbst die Art zu denken und zu sprechen musste sich wandeln. Wenn wir in einer kapitalistischen Gesellschaft aufwachsen, so Luxemburg, ist der Sozialismus für uns unbegreiflich. Der einzige Weg dorthin sind möglichst umfassende demokratische Strukturen, in denen wir nicht nur zusammen träumen, sondern mit neuen Formen des Lebens und Arbeitens experimentieren. Am fertigen Programm eines Zentralkomitees würde die Revolution ersticken.
Wie allgemein bekannt ist, versuchte Lenin auch, den kapitalistischen Staat auf den Kopf zu stellen, um einen sozialistischen Staat aufzubauen, der nicht länger die Arbeiter, sondern die Bourgeoise unterdrückt. Genau vor dieser Umkehrung hat Fanon stets gewarnt. Die Helden im antikolonialen Befreiungskampf sind nicht unbedingt die besten Führungsfiguren einer neuen revolutionären Ordnung. Gewalt trägt die Gefahr der Rephallisierung in sich: Macho-Männer, die mit Gewehren herumstolzieren.
Für Rosa Luxemburg sind die grundlegenden demokratischen Freiheiten wie die Presse- und Versammlungs- sowie Koalitionsfreiheit absolut fundamental für die persönliche Befreiung aus Ausbeutungsverhältnissen. Sie zu verweigern blockiert die Vorstellungskraft und steht neuen Institutionen und Formen des Zusammenlebens im Sozialismus im Weg.
»Freiheit nur für die Anhänger der Regierung, nur für Mitglieder einer Partei – mögen sie noch so zahlreich sein – ist keine Freiheit. Freiheit ist immer nur Freiheit des Andersdenkenden. Nicht wegen des Fanatismus der »Gerechtigkeit«, sondern weil all das Belehrende, Heilsame und Reinigende der politischen Freiheit an diesem Wesen hängt und seine Wirkung versagt, wenn die »Freiheit« zum Privilegium wird« (Luxemburg 2018, 214).
Dem liegt erneut Luxemburgs Vorstellung von Transformation als einem Prozess zugrunde, der uns selbst und unsere sozialen Beziehungen grundlegend umgestaltet. Das Ergebnis dieses Prozesses können wir schlicht nicht voraussehen, es kann nur aus einem massenhaften kreativen Handeln entstehen.
»Die stillschweigende Voraussetzung der Diktaturtheorie im Lenin-Trotzki’schen Sinn ist, daß die sozialistische Umwälzung eine Sache sei, für die ein fertiges Rezept in der Tasche der Revolutionspartei liege, dies dann nur mit Energie verwirklicht zu werden brauche. Dem ist leider – oder je nachdem: zum Glück – nicht so. Weit entfernt, eine Summe fertiger Vorschriften zu sein, die man nur anzuwenden hätte, ist die praktische Verwirklichung des Sozialismus als eines wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen Systems eine Sache, die völlig im Nebel der Zukunft liegt. Was wir in unserem Programm besitzen, sind nur wenige große Wegweiser, die die Richtung anzeigen, in der die Maßnahmen gesucht werden müssen, dazu vorwiegend negativen Charakters. Wir wissen so ungefähr, was wir zuallererst zu beseitigen haben, um der sozialistischen Wirtschaft die Bahn freizumachen.« (Ebd., 215)
Das von Lenin und Trotzki adaptierte Konzept der Diktatur hielt Luxemburg für undemokratisch. Die »Diktatur des Proletariats« war ursprünglich ein Begriff, mit dem Friedrich Engels die Pariser Kommune beschrieb. Diese verfügte jedoch über umfassende demokratische Institutionen, darunter eine kollektive Kinderbetreuung, die unter Selbstverwaltung der Erzieherinnen stand. Sie setzte die Kreativität der Massen frei, die an den alltäglichen Arbeiten beteiligt waren. Während ihrer kurzen Lebensdauer war sie in der Tat eine permanente Revolution und umfassende Demokratisierung.
Für Luxemburg lag im Konzept der Diktatur sowohl in der Theorie wie auch in der Praxis ein Fehler. Aus der Zentralisierung der Partei entstehe unweigerlich Korruption, weil Parteiloyalität die Basis für Gefälligkeiten wird und weil sich Hierarchien verfestigen. Die Lösung sah Luxemburg anders als Lenin und Trotzki nicht in der Stärkung der Parteidisziplin oder Maßnahmen wie dem Kriegsrecht. Die Revolution müsse den Idealismus der Menschen freisetzen. Dafür müsse die Kreativität als ihr wahres Herzstück anerkannt werden.
An dieser Stelle sei betont, dass Luxemburgs Kritik keineswegs naiv war und sie Lenin und Trotzki als ihre Genossen ansprach. Sie unterstütze den Mut der Bolschewiki, nach der Staatsmacht zu greifen und die extrem schwierigen Umstände waren ihr bekannt. Ihre Kritik zielt darauf, dass die Bolschewiki aus der Not eine Tugend gemacht und daraus eine allgemeine Theorie über die Transformation zum Sozialismus abgeleitet hatten.
Ethischer Feminismus und die Macht der Sanftheit
Doch warum ist Luxemburgs Kritik an Lenin und Trotzki feministisch? Ich verstehe Luxemburg als ethische Feministin, weil sie gegen jede Struktur kämpfte, die eine Spaltung in Menschen erster und zweiter Klasse schuf, auch die Herrschaft einer Parteielite. In diesem Sinne ist das Vertrauen in die Massen auch ein feministisches Prinzip. Luxemburgs Vision des Sozialismus erfordert eine anhaltende Transformation von uns allen – von egozentrierten kapitalistischen Wesen hin zu Menschen, die respektvoll miteinander leben und das praktizieren, was ich in Anlehnung an die Philosophin Dufourmantelle »die Macht der Sanftheit« nenne. Für Dufourmantelle ist Sanftheit weder ein philosophisches Konstrukt noch ein soziologisches Verhältnis, sondern ein Begriff, der eine andere Form der Beziehung zwischen den Menschen und zwischen Menschen und anderen Wesen denkbar macht.
»Sanftheit erfindet ein erweitertes Jetzt. Wir sprechen über Sanftheit, erkennen sie an, tragen sie weiter, sammeln sie, erhoffen sie. Es ist der Name eines Gefühls, dessen Namen wir vergessen haben, das aus einer Zeit kommt, als die Menschheit noch nicht von den Elementen getrennt war, von den Tieren, dem Licht und den Geistern. Wann ist sich die Menschheit dessen bewusst geworden? Was stand der Sanftheit gegenüber, als Leben und Überleben noch eins waren?« (Dufourmantelle 2018, 10)
Der ethische Feminismus gründet auf einer gewaltfreien Beziehung zum anderen. Dies ist nicht auf Gewaltfreiheit zu reduzieren; manchmal ist Gewalt eine tragische Notwendigkeit, etwa in antikolonialen Kämpfen.
Sie sollte aber weder idealisiert noch auf das Werk einer kleinen Zahl von Männern reduziert werden. Fanon beschrieb Letztere als Teil eines Prozesses der Rephallisierung mit der daran geknüpften Fantasie, der unterdrückte, männliche Kolonisierte könne vom Phallus des weißen Mannes Besitz ergreifen. Eine reine Fantasie – aber eine, die konterrevolutionäre Politiken nährt.
In »Feminist Contentions« habe ich das Konzept des ethischen Feminismus noch auf zwischenmenschliche Beziehungen beschränkt, heute würde ich die Macht der Sanftheit mit einbeziehen. Sie ist eine wichtige feministische Antwort auf die Kritik der Posthumanisten am Marxismus, die in ihm einen weiteren Ausdruck humanistischer Hybris sehen, ausgedrückt in Marx’ Vorstellung, »der Sozialismus humanisiere die Natur und naturalisiere den Menschen« und überwinde damit die Entfremdung im Kapitalismus. Hier sind zunächst nur die menschlichen Beziehungen im Blick, die Herrschaft über die Natur bleibt unhinterfragt (Braidotti 2013). Sanftheit, verstanden auch als eine Form der Macht, führt uns dagegen zur Ablehnung jeder Herrschaft des Menschen über andere Wesen. Dies scheint Luxemburg (1917b, 333) geteilt zu haben:
»Ich weiß, für jeden Menschen, jede Kreatur ist eigenes Leben das einzige, einmalige Gut, das man hat, und mit jedem kleinen Flieglein, das man achtlos zerdrückt, geht die ganze Welt jedesmal unter, für das brechende Auge dieses Fliegleins ist alles so gut aus, als wenn der Weltuntergang alles Leben vernichtete. Nein, ich sage Ihnen von den anderen Frauen, gerade damit Sie Ihren Schmerz nicht unterschätzen und missachten, damit Sie sich selbst nicht falsch verstehen und nicht Ihr eigenes Bild vor sich selbst verzerren. Oh, wie wohl ich Sie verstehe, wenn Ihnen jede schöne Melodie, jede Blume, jeder Frühlingstag, jede Mondnacht eine Sehnsucht und Lockung nach dem Schönsten ist, was die Welt zu bieten hat.«
Ihre Empathie galt auch dem berühmten Büffel aus einem ihrer Briefe aus dem Gefängnis (vgl. auch Nachdruck in diesem Heft). Und selbst den kleinsten Tieren wie etwa Insekten, die viele nicht als fühlende Wesen betrachten, war sie zugeneigt:
»Und nun habe ich Arbeit wie jeden Sommer: Ich muß auf den Stuhl klettern und lange doch auch so kaum zur obersten Scheibe, um die Wespe behutsam zu fangen und sie wieder ins Freie zu befördern, sonst quält sie sich ja halbtot an dem Glas. Sie tun mir nie was, setzen sich mir im Freien sogar auf die Lippen, was sehr kitzelt; aber ich habe Angst, ihr wehe zu tun, wenn ich anfasse. Aber es gelingt doch schließlich, und plötzlich wird es im Zimmer still. Nur in meinem Ohr und Herzen bleibt ein sonniger Nachhall klingen.« (1917a, 204)
Es ist diese Sanftheit, die Luxemburg in ihren Briefen immer wieder als Praxis des Menschlichen beschreibt – eine Praxis, die wir auch in der Brutalität des Hier und Heute leben können. Luxemburgs ethischer Feminismus ist integraler Teil ihrer Schriften zu Nationalismus und Militarismus sowie ihrer Vision eines Sozialismus, der nicht nur die Barbarei des Kapitalismus, sondern auch den impliziten Elitismus der Bolschewiki herausfordert. Hiervon ausgehend können wir Feminismus viel breiter denken: über den Kampf für formale Gleichheit hinaus als Teil einer menschlichen Praxis, die sich im revolutionären Kampf verwirklicht. Ihre bissige Kritik am bürgerlichen Feminismus sollte dabei nicht als Kritik des Feminismus an sich verstanden werden. Sie richtete sich gegen die Privilegien bürgerlicher Frauen in den kapitalistischen Zentren in Bezug auf Klasse und »Rasse«. Um die Kämpfe von Transgendern, Schwulen und Lesben zu kennen, hat Luxemburg nicht lang genug gelebt, doch es scheint klar, dass sie niemandem die volle Menschlichkeit abgesprochen hätte, weil er oder sie anders leben oder lieben wollte. Ihre Idee einer neuen Praxis des Menschlichen war ihrer Zeit weit voraus.
Aus dem Englischen von Tim Jack und Sebastian Landsberger
Dieser Text erschien zuerst als Publikation des New-York-Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wir drucken eine gekürzte Fassung.
Literatur
- Adler, Georg/Laschitza, Annelies (Hg.), 2013: The Letters of Rosa Luxemburg, New York
- Benhabib, Seyla/Butler, Judith/Cornell, Drucilla/Fraser, Nancy, 1994: Feminist Contentions: A Philosophical Exchange (Thinking Gender), New York
- Braidotti, Rosi, 2013: The Posthuman, Cambridge
- Dufourmantelle, Anne, 2018: Power of Gentleness: Meditations on the Risk of Living, New York
- Fanon, Frantz 1963: The Wretched of the Earth, New York
- Luxemburg, Rosa, 1904: Organisationsfragen der russischen Sozialdemokratie, in: GW 1, Berlin, 422–446
- Dies., 1912: Frauenwahlrecht und Klassenkampf, in: Frauenwahlrecht, Propagandaschrift zum II. sozialdemokratischen Frauentag, in: GW 3, Berlin, 159–165
- Dies., 1914: Die Proletarierin, in: GW 3, Berlin, 410–413
- Dies., 1917a: Brief an Hans Diefenbach vom 5.4.1917, in: GB 5, Berlin, 203–204
- Dies., 1917b: Brief an Sophie Liebknecht vom 24.11.1917, in: GB, 5, Berlin, 333–335
- Dies., 1918: Zur russischen Revolution, in: GW 4, Berlin, 332–365