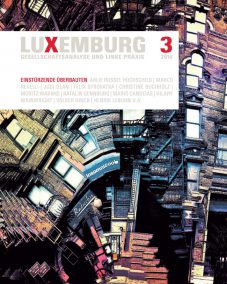| »Ich bin New York« Bilanz des kommunalen Personalausweises in New York City

»Ich bin New York.« In allen nur erdenklichen Sprachen steht der Satz auf den Postern, die derzeit überall in New York hängen: in Schulen, an Bushaltestellen, in Cafés, Nachbarschaftsläden und Bibliotheken. Die vielen unterschiedlichen Gesichter, die von den Postern lachen, erinnern ein bisschen an die Multikulti-Werbung von Benetton. Ganz unten steht in leuchtendem Orange: »Hol’ dir heute noch deinen Stadtausweis!«
Die Einführung der New York City ID, kurz IDNYC, gehört vielleicht zu den größten Erfolgen des neuen Bürgermeisters Bill de Blasio (vgl. Mogilyanskaya 2014). Im November 2013 wurde der linke Demokrat mit einer Mehrheit von 73 Prozent zum Nachfolger des Multimillionärs Michael Bloomberg gewählt. Damit endeten zwei Jahrzehnte konservativer Law-and-Order-Politik. Wie kaum eine andere Reform steht der Stadtausweis für den politischen Kurswechsel unter de Blasio und für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der neuen Regierung und den sozialen Bewegungen.
Stadtbürgerschaft in New York City
Die Idee ist einfach. Wer seine Identität und einen Wohnsitz in der Stadt nachweisen kann, erhält einen offiziellen Ausweis: die IDNYC. Dieser wird nicht nur von Verwaltungen, Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen anerkannt, sondern auch von vielen privaten Unternehmen und von der Polizei.
Die besondere Bedeutung der kleinen grünen Karte wird einem erst auf den zweiten Blick klar. Denn anders als in den europäischen Ländern gibt es in den USA kein bundesweit geltendes Ausweisdokument wie den Personalausweis. Viele Bürger*innen haben auch keinen Reisepass. Der meistbenutzte Ausweis ist stattdessen der amtliche Führerschein. Ergänzend werden oft Kreditkarten und unternehmenseigene IDs benutzt.
Gerade für Migrant*innen und marginalisierte Gruppen wie Obdachlose, aber auch für viele andere in der Stadt, ist das ein Problem. Ganz zu schweigen von den etwa 500 000 Sans Papiers, die ohne offiziellen Status in New York City leben. Ohne Ausweis wird der Alltag zu einer unberechenbaren Herausforderung. Für den Abschluss eines Mietvertrags, den Schulbesuch der Kinder oder die Mitgliedschaft in der Stadtteilbibliothek braucht man ein Ausweisdokument. Und da man ohne ID kein Bankkonto eröffnen kann, müssen ausgerechnet die Ärmsten der Armen oft horrende Gebühren für Finanzdienstleister wie Western Union zahlen. Von den Risiken, die eine polizeiliche Ausweiskontrolle mit sich bringen kann, einmal ganz abgesehen.
Hier kommt die IDNYC ins Spiel. Nach San Francisco und New Haven hat New York City als dritte Stadt in den USA ein solches kommunales Ausweisdokument eingeführt. Alle, die einen Wohnsitz in New York haben, können den Ausweis beantragen. Ausgestellt wird er von der Stadtverwaltung. Der ausländerrechtliche Status spielt dabei keine Rolle und wird auf dem Ausweis auch nicht vermerkt. Obdachlose können eine Hilfsorganisation als Adresse angeben. Und wer die ID hat, gilt als Stadtbürger*in von New York.
Teilhabe und Anerkennung in der Stadt
Lokale Politiken der Bürgerschaft werden in der Stadt- und Migrationsforschung seit den 1990er Jahren unter dem Begriff ›Urban Citizenship‹ diskutiert (vgl. Hess/Lebuhn 2014). Der Ansatz ist vor allem im angloamerikanischen Raum prominent, taucht aber zunehmend auch in der deutschsprachigen Debatte auf und bildet dort oft einen Gegenbegriff zum repressiven Integrationsdispositiv. Die Stadtforscherin Marisol García spricht von städtischen oder regionalen Formen von Bürgerschaft, wenn lokalpolitische Instrumente eingeführt werden, die soziale Teilhabe nicht nur für etablierte Bürger*innen gewährleisten oder ausdehnen, sondern auch Anwohner*innen integrieren, die keinen formalen Bürgerstatus haben.
Nicht die Staatsbürgerschaft, sondern der materielle Lebensmittelpunkt gilt als Kriterium für den Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen. Alle Menschen, die zusammen an einem bestimmten Ort leben und dort am Alltag partizipieren, sollen auch die gleichen Rechte und Pflichten haben. Dabei können die Politiken der (Stadt-)Bürgerschaft sowohl auf Proteste und Forderungen ›von unten‹ zurückgehen als auch auf innovative Praxen in Politik und Verwaltung – oder auf eine Kombination aus beidem (vgl. García 2006, 754).
Wie weit solche lokalpolitischen Strategien reichen, hängt mit dem jeweiligen politischen System zusammen. In Staaten mit einem ausgeprägten Föderalismus, wie den USA, genießen Länder und Kommunen eine relativ starke Autonomie von der Bundesregierung. Lokalpolitik hat in vielerlei Hinsicht größere Gestaltungsspielräume als in Staaten, in denen die Kommunen bloß als eine Art ›verlängerter Arm des Zentralstaates‹ fungieren. Damit ist aber noch nicht gesagt, dass Lokalpolitik unbedingt progressiver sein muss als die Politik auf Bundesebene. Gerade in den USA gibt es viele Beispiele für Lokalpolitiken der reaktionärsten Sorte – es hängt immer von den politischen Kräfteverhältnissen vor Ort ab.
In New York City wäre der neue Ausweis wohl kaum ohne die tatkräftige Unterstützung von Bürgermeister de Blasio eingeführt worden. Vor allem aber ist er das Ergebnis einer erfolgreichen Kampagne linker Bewegungen. Federführend dabei war eine der größten Nachbarschaftsorganisationen von New York: »Make the Road«. Die Organisation wurde 2007 als Zusammenschluss mehrerer kleinerer Gruppen gegründet und kämpft für die Rechte von Migrant*innen. Mittlerweile hat sie fast 20 000 Mitglieder in der ganzen Stadt.
»Wir hatten schon lange über eine ID nachgedacht«, erzählt Natalia Aristizabal. Doch erst mit de Blasio als Bürgermeister und einer Reihe von linken Abgeordneten im City Council schien die Gelegenheit gekommen. Seit zwölf Jahren arbeitet Natalia für »Make the Road«. Zusammen mit ihrer Mutter ist sie aus Kolumbien in die USA eingewandert und kennt den rassistischen Alltag in New York aus eigener Erfahrung. Zunächst holten die Aktivist*innen sich juristischen Rat. »Dann haben wir angefangen, mit Leuten darüber zu reden. Wir haben überlegt, wie man den Ausweis für alle New Yorker attraktiv macht. Denn wir wollten keine ID nur für Einwanderer. Das wäre dann wie ein Stigma gewesen.«
Als »Make the Road« in einem stadtpolitischen Bündnis mit zahlreichen anderen Gruppen die Bezirksabgeordneten und Bürgermeister de Blasio kontaktierte, stand das Konzept. Die ID sollte nicht nur als Ausweis funktionieren. Sie sollte auch vergünstigten Zugang zu Museen und anderen Kulturinstitutionen beinhalten und eine ermäßigte Mitgliedschaft in Sportvereinen ermöglichen. Die Bibliotheken hatten bereits im Vorfeld Interesse bekundet, die ID als Mitgliedsausweis zu akzeptieren. Auch die Polizei sollte unbedingt eingebunden werden. Je mehr Partner, desto besser.
Die Kräfteverhältnisse verschieben
Gruppen wie »Make the Road« sind professionelle Nachbarschaftsorganisationen mit Tausenden von Mitgliedern. Im ganzen Stadtgebiet haben sie Büroräume mit festen Öffnungszeiten, bieten Rechtsberatungen an und organisieren Graswurzelkampagnen. Und sie machen Parteipolitik. Zusammen mit anderen linken Gruppen und einer Reihe von Gewerkschaften, zum Beispiel den Ortsverbänden der Service Employees International Union (SEIU) und der Communications Workers of America (CWA), ist »Make the Road« Mitglied der Working Families Party. Die Partei wurde 1998 in New York gegründet. Heute ist sie in elf Bundesstaaten aktiv. Mit einem ungewöhnlichen Konzept versucht sie, die politischen Kräfteverhältnisse zu verschieben (vgl. Jaffe, Dezember 2015 auf LuXemburg-Online).
»Die Working Families Party hat keine eigenen Kandidat*innen«, erzählt Juan Antigua. Der junge Mann aus der Bronx ist politischer Direktor der Partei in New York City. »Wir unterstützen immer diejenigen Politiker*innen, die eine progressive Agenda vertreten und für unsere Ziele und Werte eintreten«, erklärt er die Strategie. Im US-amerikanischen Wahlsystem, in dem es oft zu Kopf-an-Kopf-Rennen kommt, kann die Working Families Party ihren Favorit*innen wichtige Prozentpunkte liefern. Sie mobilisiert unter den Mitgliedern ihrer Partnerinstitutionen und beteiligt sich am Wahlkampf. Umgekehrt wissen die Kandidat*innen, dass sie für die Unterstützung etwas tun müssen. Die Partei wird für ihren Pragmatismus oft kritisiert, vor allem, weil sie gelegentlich auch Republikaner*innen unterstützt. Doch in New York City trug sie bei den letzten Wahlen dazu bei, die Mehrheitsverhältnisse deutlich nach links zu verschieben. Fünf Prozent der Wähler*innen, die für de Blasio stimmten, gingen auf ihr Konto. Auch bei der Wahl der Abgeordneten für den City Council mischte die Partei mit und unterstützte den Progressive Caucus, eine Art linke Fraktion. «Wir haben eng mit ihnen zusammengearbeitet, damit Projekte wie der neue Stadtausweis entwickelt und umgesetzt werden können«, so Juan Antigua. Die Rechnung ging auf. Im Juni 2014 brachten drei Abgeordnete die Gesetzesvorlage für den neuen Ausweis im City Council ein.
900 000 New Yorker*innen machen schon mit
Im Sommer 2016 hat die Stadtregierung die ID erstmalig evaluiert. Die knapp 70-seitige Studie wurde von externen Gutachter*innen des Forschungs- und Beratungsinstituts Metis Associates angefertigt und steht als Download auf der Website der Migrationsbeauftragten des Bürgermeisters (vgl. Daley 2016). Neben einer Onlinebefragung und der Auswertung anonymisierter Verwaltungsdaten wurden auch qualitative Einzel- und Gruppeninterviews geführt, unter anderem mit Vertreter*innen von Nachbarschaftsorganisationen.
Die Ergebnisse sind verblüffend. Im Sommer 2016 nutzten fast 900 000 New Yorker*innen den Ausweis. Das sind etwa zehn Prozent aller Einwohner*innen. Dabei gab es die Karte zu diesem Zeitpunkt erst seit eineinhalb Jahren. Über 70 Prozent der befragten Passinhaber*innen gaben an, sie hätten die ID allein schon deswegen beantragt, um die Idee zu unterstützen. Das einseitige Antragsformular kann man in über 20 enrollment centers, die in der ganzen Stadt extra dafür eingerichtet wurden, direkt ausfüllen und abgeben. Viele davon befinden sich in Bibliotheken und Nachbarschaftszentren. Die Identität und der Wohnsitz werden mit unterschiedlichen Dokumenten nachgewiesen, die nach einem Punktesystem bewertet werden. Wer keinen Mietvertrag hat, kann zum Beispiel auch eine Kombination aus Strom-, Wasser- und Telefonrechnungen vorlegen. Das Passfoto wird direkt bei der Antragstellung gemacht. Dass die Daten von der Verwaltung für zwei Jahre gespeichert werden, war eine bittere Pille für die sozialen Bewegungen – auch wenn die Polizei keinen Zugriff darauf hat.
Die Polizei scheint die ID vorbehaltlos zu akzeptieren. Sie hatte viel Wert darauf gelegt, dass der Identitätsnachweis bei der Antragstellung streng gehandhabt wird. Im Gegenzug wurden die Richtlinien für Polizeikontrollen geändert, sodass die ID auch wirklich offiziellen Charakter hat. Das ist vor allem für die prekäre Gruppe der Sans Papiers zentral. Aber auch andere Gruppen schätzen den Ausweis sehr. Besonders beliebt ist er in der LGBTQ-Community. Im Gegensatz zu normalen Ausweisen kann man hier die Genderbezeichnung selbst wählen. Ob man dabei von dem Geschlecht auf der Geburtsurkunde abweicht, entscheidet man bei der Antragstellung selbst. Neben männlich und weiblich gibt es die Möglichkeit, auf eine Genderbezeichnung ganz zu verzichten. Auch unter Studierenden ist die Karte beliebt. Denn sie gewährt ermäßigten oder freien Eintritt zu 40 Kulturinstitutionen wie dem Museum of Modern Art oder dem Museum of Jewish Heritage.
Sicher gibt es noch einiges zu verbessern. So berichten Obdachlose, dass sie weiterhin von der Polizei drangsaliert werden, wenn auf dem Ausweis als c/o-Adresse der Name einer Hilfsorganisation vermerkt ist. Und viele Banken weigern sich, die IDNYC als alleiniges Ausweisdokument für die Eröffnung eines Kontos zu akzeptieren. Auch Kneipen und Clubs akzeptieren die ID noch nicht für den Altersnachweis. Denn dazu muss erst noch die zuständige Behörde auf Ebene des Bundesstaates New York grünes Licht geben.
Nichtsdestotrotz scheint das Projekt ein Erfolg zu sein. Für 25 Prozent aller Befragten ist die IDNYC das einzig offizielle Ausweisdokument. Für diese Gruppe hat der Ausweis einen Nutzen, der kaum zu unterschätzen ist. Das wiederum übersetzt sich auch auf die symbolische Ebene. So erklärten 77 Prozent der Migrant*innen, die für die Studie befragt wurden, dass sich mit dem neuen Ausweis auch ihr Zugehörigkeitsgefühl zur Stadt verändert habe: Sie seien nun »echte New Yorker*innen«! Dass soziale Bewegungen bei der Einführung der IDNYC eine wichtige Rolle gespielt haben, ist der Stadtregierung bewusst. Die Migrationsbeauftragte des Bürgermeisters, Nisha Agarwal, schätzt die Expertise der lokal verankerten Nachbarschaftsorganisationen. Denn die Gruppen haben einen direkten Kontakt zu ihren jeweiligen Communities. »Die Nachbarschaftsorganisationen sind für uns wichtige Partner bei der Umsetzung der IDNYC«, so Nisha Agarwal. »Sie werben unter ihren Mitgliedern für den neuen Ausweis. Viele haben Stellen eingerichtet, wo man den Ausweis beantragen kann. Außerdem beraten sie uns, wie wir das Partnerprogramm weiter ausbauen können, um den Ausweis für alle New Yorker attraktiv zu gestalten.«
Oder doch nur ein kleiner Schritt?
Trotz aller Erfolge ist der Stadtausweis nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Zum einen gilt er nur in New York City. Zum anderen kann er an der enormen sozialen Polarisierung in der Stadt wenig ändern. Einen Zugang zu sozialstaatlichen Leistungen erhält man mit dem Ausweis allein nicht. Dazu müssen auch andere Dokumente wie zum Beispiel die Sozialversicherungskarte vorgelegt werden. Das ist aber gerade den Sans Papiers kaum möglich. Und wenn es um ›echte Umverteilungspolitik‹ geht, zum Beispiel im Wohnungsbau und in der Bildungspolitik, trifft die neue Stadtregierung schnell auf mächtige Gegner*innen. Diese sitzen nicht nur in der Wall Street, sondern auch an den politischen Hebeln im Bundesstaat New York. Mit Andrew Cuomo regiert dort zwar ebenfalls ein Demokrat. Doch steht dieser lange nicht so weit links wie de Blasio. Und in vielen Fragen kann auch der mächtige Bürgermeister von New York nichts ohne die Zustimmung auf Ebene des Bundesstaates unternehmen. Noch düsterer sieht es in Washington aus. Eine umfassende Reform der Migrationspolitik ist nur auf Bundesebene machbar. Dort war schon Barack Obama an dem Versuch einer Legalisierung der fast zwölf Millionen Sans Papiers gescheitert. Mit dem Wahlsieg von Donald Trump sind hier dramatische Verschlechterungen zu erwarten.
In absehbarer Zukunft dürfte der Kurswechsel in New York also auf die lokale Ebene beschränkt bleiben. Dennoch: Die Einführung der IDNYC ist gerade für die am stärksten Marginalisierten in der Stadt von großer Bedeutung. Für die sozialen Bewegungen ist sie ein wichtiger Erfolg. Darüber hinaus hat der Ausweis auch eine Vorbildfunktion für andere Städte in den USA. Nach New York City führte im Sommer 2016 die Stadt Phoenix eine kommunale ID ein – und stellte sich damit quer zur konservativen Politik auf Ebene des Bundesstaates Arizona. Wer weiß: Vielleicht wird aus vielen kleinen Schritten ja irgendwann ein großer.
Dieser Artikel erschien in einer kürzeren Fassung zuerst in der Wochenzeit
Literatur
Daley, Tamara C. et al., 2016: IDNYC: A Tool of Empowerment. A Mixed-Methods Evaluation of the New York Municipal ID Program, New York City, www1.nyc.gov/site/idnyc/about/idnyc-program-evaluation.page
García, Marisol, 2006: Citizenship Practices and Urban Governance in European Cities, in: Urban Studies 4/2006, 745–765
Hess, Sabine/Lebuhn, Henrik, 2014: Politiken der Bürgerschaft. Migration, Stadt, Citizenship, in: sub/urban. Zeitschrift für kritische Stadtforschung 3/2014, 11–34
Mogilyanskaya, Alina, 2014: Ausweis her! New York City führt ein kommunales Personaldokument ein, in:
LuXemburg 3/2014, 142–145