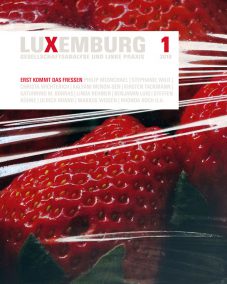| Hartz-IV-Menü und Feinkosttheke. Ernährungspolitik muss kulinarische Teilhabe für alle ermöglichen
Weltweit gibt es gemessen in Kilokalorien mehr Nahrung, als man benötigen würde, um alle Menschen ausreichend satt zu bekommen. Dass überhaupt noch gehungert wird, ist zumindest im Moment primär ein Verteilungsproblem und weniger eins der Produktion. In Deutschland ist die Fülle von Lebensmitteln offensichtlich. Die Supermarktregale sind gefüllt, allerorten gibt es Restaurants unterschiedlicher Couleur, und im Zweifel ruft man halt einen Lieferdienst, der einem das Essen bequem an die Haustür bringt. Das Schlaraffenland scheint Wirklichkeit geworden zu sein. Zumindest für alle, die dafür zahlen können. Wer dazu nicht in der Lage ist, darf durch die Schaufenster der Geschäfte gucken oder, zeitgemäßer, durch die Bildschirmscheibe in die zahllosen Kochshows, wie wohlschmeckend und ambitioniert andere kochen, kochen lassen und essen.
Von der Politik wird Ernährung oft allein unter dem ernährungsmedizinischen Prinzip diskutiert. Damit wird lediglich ein spezifischer naturwissenschaftlicher Teilaspekt thematisiert. Bei diesem dreht es sich um zwei Punkte. Zum einen wird gefragt, ob das Speisenangebot, das den Menschen so reichhaltig präsentiert wird, der Gesundheit förderlich oder eher abträglich ist. Zum anderen geht es darum, wie Konsument*innen die ihnen zur Verfügung stehende Nahrung im Sinne ihrer eigenen Gesundheit und der Volksgesundheit am besten nutzen können.
Sicherlich ist es wichtig, die Konsument*innen vor Giften im Essen und vor arglistigen Täuschungen zu schützen. Doch wenn hier erst einmal die größten und offensichtlichsten Problemfälle aus dem Weg geräumt sind, wird es schnell komplex und kompliziert. Was genau ist gesund und was nicht? Weder bei raffiniertem Zucker noch bei Glyphosat ist die Sachlage eindeutig klar. Es ist immer die Dosis, die das Gift macht. Und auch vermeintlich gesunde Lebensmittel wie Äpfel oder Kokosnüsse können, verzehrt man sie ausschließlich, in die Mangelernährung führen.
Die neue Armenspeise
Es ist eine vielfältige Ernährung, die am wahrscheinlichsten zumindest nicht krankmacht. Hier könnte man die Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) heranziehen, die für eine sogenannte vollwertige Ernährung wirbt. Nun scheint es nach Studienlage, dass sich besonders Menschen mit sozioökonomisch niedrigem Status eher nicht so ernähren, wie es sich die DGE vorstellt. Hierzu soll das penetranteste Argument gleich ausgeräumt werden, im sogenannten Hartz-IV-Regelsatz sei genügend Geld für eine gesunde, vollwertige Ernährung vorhanden. Dieser sieht 145,04 Euro für Nahrungsmittel vor. In einem Monat mit 30 Tagen sind das etwa 4,83 Euro pro Tag. Für Erwachsene wohlgemerkt. Kinder kommen mehrheitlich deutlich schlechter weg. Sicherlich, mit diesem Budget stirbt in Deutschland niemand den Hungertot. Man kaufe einfach Brot und Milch im Discounter und schon befindet man sich in einer Situation, um die viele Menschen in Ostafrika einen wohl tatsächlich beneiden würden. Doch das kann nicht der Referenzpunkt für die politische Klärung der Ernährungsfrage sein. Denn satt allein heißt noch nicht einmal, wenn man auf die physiologischen Parameter schaut, genug. Hier stößt man auf das Phänomen des »versteckten Hungers«.
Wie viel Geld man in Deutschland tatsächlich für Nahrungsmittel benötigt, die im Sinne der DGE zu einer »vollwertigen Ernährung« beitragen, ist in Fachkreisen umstritten. Einig ist man sich aber darüber, dass fünf Euro nicht reichen. Langfristig droht eine physiologische Mangelernährung als Folge. Das heißt, die Ernährungssouveränität der Menschen, denen lediglich der Hartz-IV-Satz zur Verfügung steht, ist extrem beschnitten. Da helfen auch keine zynischen »Hartz-IV-Speisepläne«, wie sie der ehemalige Berliner Finanzsenator Sarrazin aufgestellt hat. In diesen war akribisch dargelegt, was Leistungsempfänger*innen an welchem Wochentag kochen und essen sollen. Mal davon abgesehen, dass man hier sieht, dass nicht jeder, der es versteht, den Sozialstaat zu schleifen, auch ein Talent für schmackhaftes Kochen mitbringt, zeigt dieser Diätplan deutlich: Man hat sich gar nicht so sehr von mittelalterlichen Speiseregularien emanzipiert. Damals wurde auch zwischen Bauern- und Herrenspeise unterschieden. Die Aristokratie regelte zum Teil detailliert, welcher Schicht welches Essen zustand. Selbstverständlich war es nur »natürlich«, dass erlesene Speisen wie Weißbrot oder delikate Vögel den höheren Schichten vorbehalten waren, während die unteren Schichten dunkles Brot und Haferschleim aßen. Jetzt gibt es also wieder die definierte »Prekariatsspeise« und zu dieser gehören weder zertifizierte Bioprodukte noch Artikel von der Feinkosttheke.
Klasse Geschmack
Doch Gesundheit ist bei der Ernährung nicht alles. Essen und Trinken sind nicht nur eine spezifische Kategorie des medizinischen Systems, sondern sie sind die grundlegendste Kulturtechnik menschlichen Lebens, vor allem auch des Zusammenlebens. Darüber, wie, wo und mit wem man isst und trinkt, kann man sich mit anderen Menschen vergemeinschaften. Ein gemeinsam entwickelter Geschmack drückt Gefühle sozialer Zugehörigkeit aus – oder man kann sich durch die Ernährungspraxis abgrenzen und Eigenständigkeit betonen. Religiöse Nahrungstabus wie von Schweinfleisch bei Muslimen und Juden oder das katholisch-christliche Gebot des Fleischverzichts an jedem Freitag sind allgemein bekannt und drücken dieses Wechselspiel von speisenbezogener Gruppenzugehörigkeit und Grenzziehung aus. Was jedoch immer wieder vergessen wird, ist, dass es alimentäre Grenzziehungen auch in säkularer Form gibt: Ökologisch orientierte Tierrechtsaktivisten bekommt man nur schwer zu McDonald’s, in einer Hip-Hop-Peer-Group ist mit Dinkelkeksen schlecht Eindruck zu schinden und dem Bildungsbürgertum kann man zwar inzwischen problemlos asiatische Insektengerichte präsentieren, aber man erntet nur Ekel und abschätzige Blicke, wenn man Preacher’s Chicken Ketcha-Cola aus einem der White-Trash-Cooking-Bücher serviert.
Über den Ernährungsstil, den man pflegt – also die Lebensmittel, die man einkauft oder meidet und auf unterschiedliche Arten zubereitet –, sowie über die Restaurants, die man besucht oder über deren Schwelle man nie den Fuß setzen würde, drücken Menschen ihre soziokulturelle Persönlichkeit aus. Wer am Existenzminimum lebt, dem wird diese Möglichkeit genommen. Die Ernährungssouveränität ist nicht nur in Hinsicht auf die gesundheitlichen Möglichkeiten beschränkt, sie ist in Bezug auf die soziokulturelle Teilhabe, die in diesem Fall kulinarische Teilhabe genannt wird, nahezu außer Kraft gesetzt.
Die Ernährungssouveränität ist da komplett ausgehebelt, wo die Menschen keine eigenen Mittel mehr zur Verfügung haben, selbst zu entscheiden, was sie essen wollen. Etwa wenn sie vorrationierte zusammengestellte Lebensmittelpakete erhalten oder wenn sie gezwungen sind, zu einer der Tafeln zu gehen, wo sie Lebensmittel erhalten, die andere als überflüssig deklariert haben. Zumeist haben jedoch selbst die sozioökonomisch Schwächeren in Deutschland ein kleines Budget zur freien Verfügung, um ihre Lebensmittel einzukaufen. Berufspolitiker*innen mit ansehnlichen Einkünften ebenso wie professionalisierte Ernährungsberater*innen sehen jedoch mit Sorge, dass sich viele Menschen nicht an wissenschaftlichen Nährwerttabellen orientieren, sondern an Geschmack, Bequemlichkeit, Tradition, persönlichem Vertrauen oder gar hedonistischem Genuss. Anstatt saisonal, regional, zucker- und fleischreduziert zu essen und zu trinken, werden Softdrinks, Cheeseburger und Süßwaren gekauft.
Negative Geschmacksbildung
Bürgerliche Ernährungs- und Sozialpolitiker*innen sehen in dieser Ernährungspraxis meist ein Bildungsdefizit. Offensichtlich sind die sozioökonomisch Schwächeren nicht nur arm an finanziellen Mitteln, sondern auch an Ernährungswissen. Sie opfern ihre Gesundheit auf dem Altar des schnellen Wohlgeschmacks und sind aufgrund ihres Unwissens leichte Opfer ernährungsindustrieller Verführungsstrategien. In Aufklärungskampagnen und mit Bildungsofferten wird versucht, die Konsument*innen von Fast Food, industriell produziertem Essen, Zuckergebäck oder zu viel Fleisch abzubringen und zu belehren, wie man sich auch anders, gesünder und gleichzeitig günstig ernähren kann. Oft wird dabei das Argument ins Feld geführt, das gesunde Essen oder die vorgeblich natürlichen Produkte würden sogar besser schmecken. Weil der mit viel Liebe zubereitete Kohlsalat dann aber vielleicht doch nicht die geschmackliche Durchschlagskraft entfaltet, dass die adressierten Essenden dafür ihre bisherigen Mahlzeiten aus dem Speiseplan streichen würden, wird als nächster Schritt auf die negative Geschmacksbildung umgestellt. Das heißt, dass dort, wo die propagierte Alternative sich nicht von allein durchsetzt, die bisherig bevorzugte Variante geschmacklich oder moralisch abgewertet wird. In religiösen Kulturen geschieht dies, indem man die zweifelhafte Praktik mit sündhaftem Verhalten und mit Höllenvorstellungen in Beziehung setzt, sodass Gläubige stets fürchten müssen, postmortal für ihre Verfehlungen zu büßen.
In der säkularisiert-bürgerlichen Klassengesellschaft werden die Ernährungspraktiken des Prekariats hingegen mit gesundheitlichen Folgeschäden, moralischer Verkommenheit sowie verschwenderischer Unvernunft assoziiert. Das Mantra der ungesunden Lebensmittel etwa aus industrieller Produktion wird so oft wiederholt, im Übrigen auch von linker Seite, bis denjenigen, denen ihr bisheriges Essen damit diskursiv kontaminiert wird, entweder angst und bange wird oder es sie beschämt. Die Teilnehmerin eines Workshops für Ernährungsberater, in dem ich als Dozent tätig war, äußerte den vielsagenden Satz: »Wir wollen ja niemandem etwas verbieten, aber es muss schon wehtun, wenn man zu diesen Produkten greift!«
Als nächster Schritt wird eine Sanktionsgewalt eingefordert, die, wenn schon die soziale Ächtung nicht greift, über den Preis laufen soll. Über Mindestpreise oder Verbrauchssteuern auf Zucker, Fett oder Fleisch soll die Ernährungspraxis gesteuert werden. Allerdings ist es nicht so, dass diese Produkte allein in den sozioökonomisch schwächeren Schichten verzehrt werden. Doch wie bei jeder Preiserhöhung findet hier die Transformation von Produkten aus dem Bereich des Alltäglichen in die Sphäre der Luxus- und Prestigegüter statt. Es mag sich heutzutage kaum jemand mehr daran erinnern, aber nicht nur Fleisch war einst eine Herrenspeise. Auch Eiscreme und Schokolade standen jahrhundertelang nur den Oberschichten zur Verfügung.
Es ist bei allen Sympathiebekundungen breiter Teile der Linken für antiindustrielle Ideen und Bewegungen nicht möglich, einfach darüber hinwegzugehen, dass mit der Industrialisierung – und zwar im Agrarsektor wie auch bei der Lebensmittelproduktion – eine Demokratisierung des Alimentären und der kulinarischen Teilhabe erreicht werden konnte. Sehr großen Teilen der Bevölkerung wurden vormals restriktiv gehandelte Lebensmittel und exklusive kulinarische Kultur zugänglich gemacht. Unbestritten muss über ökologische und ökonomiedemokratische Fragen bezüglich dieser Produktionsweise debattiert werden. Durch Preiserhöhungen allein würden diejenigen, die unter Budgetrestriktionen stehen, allerdings zwangsweise auf Diät gesetzt. Diejenigen, denen das Geld lockerer in der Tasche sitzt, werden weiter essen und trinken können, was sie wollen.
Sich etwas zu gönnen, das schmeckt und das einem das Gefühl gibt, an den Esskulturen der Weltgesellschaft teilzuhaben, etwas, dem auch zentrale Bezugspersonen einen Wert zuschreiben und nicht nur verkrampft freundliche, doch ebenso offensichtlich belehrende Ernährungsbeauftragte – alles legitime Gründe, den Speiseplan nicht einfach auf Druck »von oben« umzustellen.
Das gilt auch für den Kampf gegen das industriell produzierte Convenience Food. Das entkrampfte Verhältnis zum Fertigessen führt zu panischen Sorgen vor einem Niedergang der Esskultur. Klar, wer es sich leisten kann, jeden Tag außer Haus zu essen, hat gut reden. Doch viele, bei denen das Geld nicht so locker sitzt, haben nach einem anstrengenden Arbeitstag keine Energie mehr, die dann doch nicht immer so lustvolle Alltagsküche zu erledigen. Diese bleibt im Übrigen immer noch überwiegend an den Frauen hängen. Wer die Zeit anders verwenden möchte, zum Beispiel für politisches Engagement, der greift ins Gefrierfach oder zur Dose. Wer nicht an der neuen bildungsbürgerlichen Lust am Kochen partizipieren kann oder will, wird jedoch schnell diskreditiert. Natürlich sollte ein entspannter Koch- und Essgenuss jenseits ökonomischer Rationalisierung allen offenstehen. Zugleich muss es aber allen möglich sein, dieser Pflicht zum tätigen Genuss auch kritisch gegenüberzustehen.
Im 19. Jahrhundert gab es schon einmal eine Form bürgerlichen Aufklärungspaternalismus. Die unteren Schichten sollten zur gesunden und maßvollen Ernährung gemäß ihrem sozialen Status erzogen werden. Wie in der Gegenwart wollte man den ärmeren Bevölkerungsgruppen vermitteln, dass sich auch mit wenig Geld passabel leben lässt, vorausgesetzt, man gibt sich mit der Budgetplanung Mühe und misst die Ansprüche nicht am reich gedeckten Tisch der Oberschicht. Die aufkommende sozialdemokratische Arbeiterbewegung fand das allerdings nicht so plausibel wie mancher Nachfahre 150 Jahre später. Julius Posts schilderte 1889
»eine heftige Ablehnung vieler Arbeiter gegenüber der Verteilung von Schriften zur Ernährung und Haushaltsführung. Dieses Vorgehen wurde als Maßregelung und Gängelung empfunden. Geschürt wurde der Unmut über derartige Verstöße durch die teils massive Kritik der Sozialdemokratie. Insbesondere die in den Arbeiterlehrbüchern gepredigte Genügsamkeit und Gottesfürchtigkeit wurde verurteilt. Gleichzeitig prangerten Sozialdemokraten […] die vorgegebenen Mahlzeitenpläne als Heuchelei und Instrument des Bemühens an, die Arbeiter zu einer den Niedriglöhnen angepassten Lebensweise zu erziehen.« (Hierholzer 2010, 285)
Kulinarische Teilhabe
Was bedeutet diese Einführung in das politökonomische Feld der Ernährungskultur nun für die Linke? Dass sie sich beim Thema Ernährung nicht allein auf den medizinisch-physiologischen Standpunkt beschränken darf. Essen und Trinken besitzen immer eine soziokulturelle Komponente. Wer einen Kindergeburtstag feiern will und kein Geld für Kuchen und Limonaden übrig hat, wer zu einem politischen Event gehen will und selbst im linken Infoladen zwei Euro für ein Getränk berappen muss, wer nie eine Meinung zu einer neuen alimentären Entwicklung vorzubringen vermag, weil die dazugehörigen Produkte oder die dazugehörige Gastronomie nahezu unbezahlbar sind, ist von kulinarischer Teilhabe an der Gesellschaft ausgeschlossen und wird oft mit sozialer Scham belegt. Ein anvisierter Ernährungswandel in der Gesamtgesellschaft muss demokratisch ablaufen. Dazu gehört auch, andere Ess- und Geschmacksvorlieben ernst zu nehmen, sie erst einmal zu verstehen, anstatt sie imperativ zu stigmatisieren und mit der Preiskeule autoritär ausmerzen zu wollen. Das kann im Übrigen ungewollte Rückkopplungseffekte mit sich bringen. Preiserhöhungen werten Produkte auf. Wenn sie dann auch noch von den höher stehenden Schichten weiter gern verzehrt werden, steigt der Appetit auf sie an. Auch kulinarische Egalität lässt sich am ehesten über eine Angleichung der sozioökonomischen Verhältnisse erreichen, also über mehr Einkommensgerechtigkeit, Umverteilung von Vermögen und über partizipative Bildung. Das ist zwar schwieriger, als einfach per Dekret Nahrungstabus zu erlassen. Doch es ist die sozialere und demokratischere Variante.
Literatur
- Hierholzer, Vera, 2010: Nahrung nach Norm, Göttingen