| „Es wird jetzt mehr als deutlich, dass Krankenhäuser nicht nach Profit funktionieren“
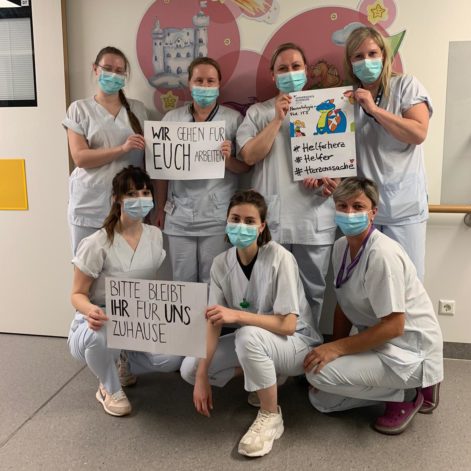
Seit der Coronakrise blicken alle Augen auf die Situation in den Krankenhäusern, die allerdings schon vorher nicht besonders gut aussah. Die jahrelangen Warnungen von Pflegekräften wurden ignoriert, Personalmangel und Zeitdruck hingenommen. Jetzt werden die Krankenhäuser noch dringender gebraucht als zuvor – und obwohl die Beschäftigten ihr Bestes geben, ist die Personalsituation angespannt. Am Universitätsklinikum Jena (UKJ) habt ihr Euch in dieser Situation entschieden, einen offenen Brief an die Klinikleitung und die landespolitisch Verantwortlichen zu verfassen. Warum?
Im Zuge der Coronakrise mussten wir feststellen, dass es in unserem Klinikum eine sehr intransparente Kommunikation mit den Beschäftigten an der Basis gibt. Darüber hinaus gibt es im aktuellen Krisenstab am UKJ keinerlei Beteiligung der Beschäftigten. Das war ein Hauptgrund für die Initiative. Eine zentrale Forderung des Briefes ist daher, dass Pfleger und Schwestern aus verschiedenen Bereichen und auch Ärzt*innen an diesem Krisenstab beteiligt werden: um eine transparente Kommunikation zu schaffen und wichtige Informationen für alle zugänglich zu machen. Und diese wichtigste Forderung wurde bereits erfüllt: Im Krisenstab sitzt seitdem eine Person aus der Pflege und eine Kollegin aus dem Personalrat, die Mitverfasserin des Briefes war.
Eine weitere Forderung des Briefes ist es, alle „elektiven Eingriffe“ bis auf Weiteres zu verschieben. Was bedeutet das?
Elektive Eingriffe sind etwas Planbares, das nicht auf Grund eines Notfalls durchgeführt wird. Zum Beispiel wenn nach einem Knochenbruch im Arm das eingesetzte Metall wieder entfernt wird. Aber auch solche Eingriffe bergen immer das Risiko, dass etwas schief geht und der Patient auf die Intensivstation muss und dort ein Bett belegt. Um genau das zu vermeiden, sollten solche Eingriffe jetzt ausgesetzt werden. Das Metall lässt sich beispielsweise auch ein halbes Jahr später entfernen, ohne dass es lebensbedrohliche Risiken für den Patienten birgt. Wenn Elektiveingriffe ausgesetzt werden, gibt es einerseits mehr Betten auf der Intensivstation und andererseits wird dadurch Personal frei, dass dort eingesetzt werden kann – und dass zudem auch Zeit benötigt, um eingearbeitet zu werden.
Nach dem letzten Wochenende war das Operationssaal-Programm für Montag, den 16.3. aber voll verplant. Das heißt, alle 28 Operationssäle, die im Uniklinikum Jena zur Verfügung stehen, sollten komplett ausgelastet werden. Zwar hat die Klinikleitung beschlossen, alle Operationen unter Vorbehalt zu planen und erst am Montag zu entscheiden, ob sie stattfinden sollen oder nicht. Letztlich wurden aber fast alle OPs an diesem Tag durchgeführt, wie schon gesagt immer mit dem Risiko, dass dabei etwas hätte schiefgehen können. Inzwischen wird die OP-Kapazität am UKJ allerdings Schritt für Schritt heruntergefahren. Von den 28 OP-Sälen sind nach ein paar Tagen immerhin sieben frei. Innerhalb des Klinikums wird das unterschiedlich gehandhabt: Es gibt Abteilungen, die ihre Patienten vorbildlich abbestellt haben und andere, die das nicht tun.
Warum führen die Krankenhäuser die OPs weiter durch, obwohl sie wissen, dass dann Intensivbetten für Notfallpatient*innen nicht zur Verfügung stehen?
Es ist wohl noch nicht im Bewusstsein der Leute angekommen, dass es eine Krise gibt und eine stärkere Belastung auf die Krankenhäuser zukommt. Deswegen ist es notwendig, von Seiten der Beschäftigten Druck aufzubauen. Am Dienstag hat unser Krisenstab noch einmal getagt und alle Abteilungen aufgefordert, das OP-Programm soweit wie möglich zu reduzieren. Nur Tumoreingriffe oder bestimmte lebensnotwendige Operationen sollen noch durchgeführt werden. Das läuft jetzt an. Es hat aber viel zu lange gedauert. Ich denke, dass das eine Wirkung von unserem Brief ist. Am Montag lief der Betrieb noch ganz normal weiter und erst seit Dienstag werden diese Forderungen umgesetzt. Am Wochenende haben wir auch mit Vertreter*innen der Landesregierung Kontakt aufgenommen. Ich denke, dass aus dem Ministerium entsprechender Druck aufgebaut wurde.
Warum braucht es diesen Druck? Warum machen die Kliniken das nicht von selbst?
Ein großes Problem ist für die Kliniken natürlich die Finanzierung. Die Krankenhäuser bekommen nur die Operationen bezahlt, die sie durchführen. Räumen sie nun Betten frei oder sagen OPs ab, ohne dass die Betten direkt belegt werden, dann fehlen ihnen Einnahmen. Das ist das große Problem in der Krise. Daher war es eine zentrale Forderung von verschiedenen Seiten, dass das Gesundheitsministerium in Berlin die Kostenausfälle bezahlt. Wenn es diese Zusage nicht gibt, ist eine Reduzierung des Programms nicht möglich. Dahinter steht aber natürlich das grundlegende Problem einer Finanzierung durch das Fallpauschalensystem mit den DRGs1, die permanenten Kostendruck aufbauen. Dieses System hat dazu geführt, dass die Krankenhäuser ihre Betten soweit reduziert haben, dass für solche Krisen keine Reserven vorhanden sind. Denn leerstehende Betten bringen den Krankenhäusern keine Erlöse, sondern kosten Geld, das im DRG-System nicht erstattet wird. In der aktuellen Krise zeigt sich, was die Ökonomisierung im Krankenhaus bewirkt hat.
Ihr habt schon vor der Coronakrise auf die Situation aufmerksam gemacht und unter anderem den Personalmangel beklagt. Eine gute Versorgung war also schon im ganz normalen Krankenhausalltag nicht gegeben. Was ist in den letzten Jahren schiefgelaufen und was muss sich ändern nach der Krise?
Man hat das Gesundheitssystem dem Markt preisgegeben. Viele Krankenhäuser wurden privatisiert und Pflegeeinrichtungen an Finanzunternehmen oder Aktiengesellschaften verscherbelt. Mit dem Ergebnis, dass dort versucht wurde, so wenig Ressourcen wie möglich einzusetzen und den höchstmöglichen Profit zu erwirtschaften. Diese Logik hat auch in öffentlichen Krankenhäusern Einzug gehalten. Es ging also nicht mehr vorrangig um eine gute Versorgung, sondern darum, dem Kostendruck Stand zu halten. Das hat Folgen auch für die jetzige Situation.
Darüber hinaus hat die Politik in den letzten Jahren massiv Investitionen im Krankenhausbereich gestrichen. Die Häuser mussten Investitionen wie etwa die Anschaffung neuer Geräte zum Teil selbst finanzieren, wodurch beim Personal gespart wurde. Das darf es in Zukunft nicht mehr geben. Es kann nicht sein, dass ein Krankenhaus Profite erwirtschaften muss und Fragen der Versorgung zu Gunsten von Gewinnen in den Hintergrund treten. Deswegen brauchen wir eine andere Finanzierung in den Krankenhäusern.
In meinen Augen muss zudem jedes Krankenhaus zurück in öffentliche Hand. Das bedeutet auch ein Ende der Krankenhausschließungen. Private Unternehmen schließen heute Krankenhäuser, die nicht mehr rentabel sind, obwohl sie einen wichtigen Versorgungsauftrag für die Region haben und beziehen nicht einmal politische Entscheidungsträger mit ein. Die jetzige Krise zeigt, dass es eine demokratische Planung braucht, die sich an den Bedarfen der Menschen und der Versorgungssituation in der Region ausrichtet.
Das ist eine interessante Forderung. Inwiefern fordert ihr auch Mitbestimmung für eine solche Bedarfsplanung? Ihr habt ja in eurem Brief gefordert, am aktuellen Krisenmanagement beteiligt zu werden. Kann das ein Probelauf für eine partizipative Bedarfsplanung sein? Inwieweit ließe sich das nach der Krise fortführen?
Zunächst hoffe ich sehr, dass sich im Nachgang dieser Krise viele zusammentun und gemeinsam für ein anderes Gesundheitssystem kämpfen. Das ist meine große Hoffnung. Wir haben in den Brief auch geschrieben, was sich nach dieser Krise ändern muss – und es gibt bei uns sehr viele, die dafür kämpfen werden, dass das auch in Berlin gehört wird.
Und in Bezug auf die Mitsprache im Krisenstab würde ich sagen: Die Menschen aus der Pflege wissen sehr genau, welche Patient*innen auf welcher Station sind und wieviel Personal notwendig ist, um ihnen gerecht zu werden. Das weiß niemand, der in einem Vorstand sitzt und Betriebswirtschaft studiert hat. Das wissen die Leute vor Ort. Ebenso wissen die Ärzte vor Ort, was es braucht um Patient*innen über medizinische Eingriffe und Krankheiten richtig aufzuklären, und wie viel Personal es braucht, um auch in schwierigen Situationen Zeit für ein Gespräch zu finden – alles Dinge, die in den letzten Jahren gar nicht mehr möglich waren. Deswegen ist es dringend notwendig, dass wir auch bei der Planung der Prozesse im Krankenhaus mitsprechen dürfen. Das ist in der Krise wichtig, aber es wird auch nach der Krise wichtig bleiben.
Ein Vorschlag, der in Bezug auf die Personalsituation diskutiert wird, ist eine sogenannte PflegePersonalRichtlinie (PPR2.0), die Verdi, der deutsche Pflegerat und die deutsche Krankenhausgesellschaft ausgearbeitet haben. Dabei geht es darum, den Personalbedarf bis auf die einzelnen Stationen im Krankenhaus zu bemessen und gesetzlich festzulegen. Wie schätzt du diesen Vorschlag ein? Würde das Eure Situation am UKJ verbessern?
Ich glaube, dass die Vorgabe für viele Krankenhäuser dringend notwendig ist. In der jetzigen Situation besteht vielleicht die Chance, dieses Gesetz so schnell wie möglich zu verabschieden, damit es möglichst bald Wirkung zeigen kann. Ich finde das wichtig und einen Schritt in die richtige Richtung.
Im Moment wird von allen Seiten gefordert, der Pflege mehr Anerkennung zu geben, weil sie die Corona-Krise managen muss. Gleichzeitig sagt ihr seit Jahren, dass ihr eine Dauerkrise managt. Was denkst Du, wenn Du das jetzt hörst?
Wenn nach der Krise noch genauso gesprochen wird, würde ich mich sehr freuen. Ich glaube aber, dass viele Politiker nur die Bevölkerung beruhigen wollen. Wenn ein Herr Spahn nach der Krise tatsächlich die Krankenhausfinanzierung rigoros ändert und Bedarfsplanung einführt, würde mich das sehr freuen. Aber ich glaube nicht daran. Wir müssen diese Krise dafür nutzen, von unten Druck aufzubauen und die Politik zu zwingen, das zu ändern, was fünfundzwanzig Jahre falsch gelaufen ist. Es wird jetzt mehr als deutlich, dass die Krankenhäuser nicht nach Profit funktionieren. Wenn überall gespart wird, nicht zuletzt am Personal, dann sind die Krankenhäuser für solche Krisen nicht gut aufgestellt. Wer es jetzt ernst meint mit der Anerkennung für die Pflege, der muss auch nach der Krise mit uns dafür kämpfen, dass das Finanzierungsmodell der DRGs abgeschafft wird.
Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, in einem der Bündnisse für mehr Personal aktiv zu werden, die rund um die Tarifbewegung „Entlastung“ entstanden sind, zum Beispiel auch hier in Jena. Die Idee war, einerseits eine breite Akzeptanz für unsere Aktionen für den Tarifvertrag Entlastung zu bekommen und viele verschiedene Akteur*innen dahinter zu versammeln, andererseits auch vom Know-how der anderen, zum Beispiel vom Bündnis Frauenstreik in Jena, zu profitieren. Wir wollen auch in Zukunft Menschen darüber aufklären, wie es in den Krankenhäusern falsch läuft und was die Ursachen sind. Wir mobilisieren gegen das DRG-System und für eine bedarfsgerechte Planung im Gesundheitswesen – und natürlich zuallererst für mehr Personal im Krankenhaus.
Das Gespräch führte Julia Dück.
Anmerkung
1 Die diagnosebezogenen Fallgruppen (kurz: Diagnosis Related Groups – DRGs) sind ein Steuerungsinstrument zur Mittelverteilung im Gesundheitswesen. 2003 ersetzte es in Deutschland das bis dahin geltende System der tagesgleichen Pflegesätze. Seitdem wird nur noch nach Pauschalen vergütet, d.h. die DRGs gruppieren Patient*innen anhand von Diagnosen, Prozeduren und anderer Merkmale ein und ordnen der DRG einen Wert zu. Damit wird letztlich der Wert berechnet, den die Kassen an die Krankenhäuser pro Fall zahlen. Es ist dabei jedoch unerheblich, ob die real entstanden Kosten für das Krankenhaus höher lagen als die Pauschale. Bezahlt werden also nicht die tatsächlich entstandenen Kosten.






