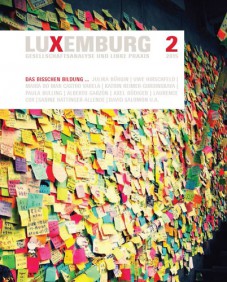| Der Name der Zeit: Vorwärts in den Kalten Wirtschaftskrieg!

Als die verheerendsten Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09 vorbei waren, kamen die meisten BeobachterInnen zu der nüchternen Erkenntnis, dass sich der globale Kapitalismus kaum verändert habe. Die »transnationale Kapitalistenklasse« (Leslie Sklair) habe sich als gewiefter Krisenmanager erwiesen und den Status quo wiederhergestellt. Neben umfangreichen Rettungspaketen für den Finanzsektor flossen nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) allein bis Mai 2009 über 1,9 Billionen US-Dollar in Konjunkturpakete.
Bei der Koordination spielten die G-20 und die Zentralbanken der größten Volkswirtschaften eine Schlüsselrolle. Das »befremdliche Überleben des Neoliberalismus« (Colin Crouch) in den entwickelten kapitalistischen Staaten war demnach vor allem den Interventionen dieser (neo)liberalen Internationale aus Staatschefs, BankerInnen, BürokratInnen und Konzernvorständen zu verdanken. Ausgegangen wird dabei von der impliziten Grundannahme, dass sich der Kapitalismus transnationalisiert und dadurch zwischenstaatliche Konflikte an Bedeutung verloren haben.
Gegen die Transnationalisierungthese ist wenig einzuwenden. Seit 1970 hat sich der Welthandel mehr als versechzigfacht, die Direktinvestitionsflüsse haben sich mehr als verhundertfacht und die Anzahl der transnationalen Unternehmen mehr als verzehnfacht. Ein Drittel des Welthandels wird innerhalb von Konzernen abgewickelt. Auch hat sich der räumliche Maßstab staatlicher Politik verändert. Institutionen des Weltregierens spielen heute eine wichtige Rolle. Allerdings ist es ein Trugschluss, dass Staatenkonflikte zwischen den großen Mächten keine große Bedeutung mehr hätten. Das American Empire mag zwar die ehemaligen Kontrahenten in Europa und Japan vorerst integriert haben. Doch andere, teils hochgerüstete Staaten wie Russland und China unterhalten zwar enge wirtschaftliche Verbindungen zu den G7-Staaten, werden aber dennoch von weitgehend unabhängigen staatlichen Eliten regiert. Zwischenstaatliche Konflikte werden in dieser Konstellation zunächst mit »weichen« Mitteln der Geopolitik ausgetragen. Spitzen sie sich jedoch zu, können sie rasch zu heißen Stellvertreterkriegen werden.
Diese Erkenntnis ist durchaus hilfreich, um einige aktuelle Folgen der Krise zu verstehen. Denn die Krise hat eine räumliche Dimension. Sie hat dazu beigetragen, dass die G7-Staaten an Einfluss in der Weltwirtschaft eingebüßt haben. Darüber können auch nicht der Frackingrausch in den USA oder die Wachstumseinbrüche in Brasilien oder Russland hinwegtäuschen. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: China hat nach den Daten der Weltbank bereits die USA als Wachstumstreiber der Weltwirtschaft abgelöst und ist drauf und dran, ihnen den Status des wichtigsten Weltkonsumenten streitig zu machen. Scheinbar unaufhaltsam steigt die Anzahl der chinesischen Konzerne in der weltweiten Top 500 an. Waren es 2002 noch elf Unternehmen, sind es heute schon 95. Auch die Direktinvestitionsflüsse und Handelsströme verschieben sich merklich nach Süden und Osten. Neue Institutionen wie die BRICS-Entwicklungsbank schaffen zudem Alternativen zu den etablierten internationalen Finanzinstitutionen. Selbst klassische Wertschöpfungsketten geraten durcheinander: Apple hat seit 2010 mit Xiaomi einen neuen Konkurrenten auf dem chinesischen Markt für Smartphones bekommen. Bereits im vierten Quartal 2014 war das Unternehmen mit einem Anteil von 13,7 Prozent Marktführer.
Doch viele der tradierten Strukturen tragen weiterhin. Die Weltgeldrolle des US-Dollars und das US-amerikanische Bündnissystem bleiben bisher stabil. Die US-Eliten sind sich dieser Vorteile bewusst. Das geschickte decline management, das die Regierung Obama betreibt, baut auf diese Stärken. Die lockere Geldpolitik der US-Notenbank FED wurde von keinen Sanktionen der ausländischen Gläubiger bestraft, die mittlerweile über 6,2 Billionen US-Dollar an Schatzpapieren horten. Das US-Militär wurde restrukturiert: In Ostasien wird ein Ring von Militärbasen um das aufsteigende China gezogen, der Nahe Osten verliert aufgrund einheimischer Schiefergas- und Öleinnahmen in den USA an geostrategischer Bedeutung. Auch die europäischen Verbündeten gehen ungeachtet interner Strukturprobleme an ihrer europapolitischen Ostfront in die Offensive.
Doch die Pläne aus Washington und Brüssel stoßen auf Widerstand. Anders als in den 1990er Jahren scheinen die MachthaberInnen in China und Russland die Vorgehensweise des Westens nicht mehr stillschweigend zu akzeptieren. Chinesische Militärs schütten Sandinseln auf, um ihre Einflusssphäre im südchinesischen Meer auszuweiten. Russland annektiert die Krim und unterstützt SeparatistInnen im Donbass.
All dies sind regional begrenzte Konflikte, und es ist unwahrscheinlich, dass hieraus ein Flächenbrand wird. Aber Grenzen werden neu gezogen. Die Welt erlebt den Übergang in einen neuen Kalten Krieg, der diesmal zwischen unterschiedlichen kapitalistischen Blöcken ausgetragen wird. Geopolitische Konfrontation trotz wirtschaftlicher Verflechtung ist in diesem capitalist cold war (Richard D’Aveni) ein bloßer Nebenwiderspruch. Fraglich ist vielmehr, inwieweit China seinen wirtschaftlichen Bedeutungsgewinn politisch geltend machen kann.